Aktuelles
Erstmalig werden am Samstag, 13. April Produkte aus dem Knonauer Amt mit dem Gütesiegel regio.garantie im Verkauf sein: auf dem Frühlingsmarkt auf dem Weisbrodareal in Hausen am Albis. Die neue Regionalmarke soll Säuliämtler Produkten die verdiente höhere Wertschätzung und Bekanntheit bringen — zunächst innerhalb der Region, später aber auch darüber hinaus.
Bei den ersten rund 90 zertifizierten Produkten handelt es sich im solche aus Hofläden, also aus der landwirtschaftlichen Direktvermarktung: Die Palette reicht von Konfitüren und Sirups und Eingemachtem über Suppen und Früchtesnacks, Mostbröckli und Lammfleisch bis zu Most, Bier und Schnaps – aber auch sogenannte Non-Food-Produkte wie Schafwollduvets. Dies ist aber erst der Anfang. Es sollen weitere Produzenten und Produkte aufgenommen werden.
Auch ein Instrument für die Regionalvermarktung
Um das Gütesiegel regio.garantie zu erlangen, muss ein Produkt zu 100 Prozent aus der Region stammen, oder – wenn es ein zusammengesetztes Produkt ist – müssen die Hauptzutat vollständig und mindestens 80 Prozent aller Zutaten regional sein. Das wird von einem externen Auditor überprüft.
Echte Regionalprodukte haben den Vorteil, dass sie kurze Wege haben, die Wertschöpfung in der Region bleibt und man weiss, vom wem sie kommen. Und sie sind aufgrund ihrer regionalen Originalität einfach einzigartig.
Deswegen ist das Engagement der Standortförderung mehr als bloss ein Support für die direktvermarkende Landwirtschaft. Denn: «Regionalprodukte machen die Region auf ihre Weise sinnlich und genussvoll wahrnehmbar. Das trägt zur Identität der Region als ganzer bei. Eigentlich sind Regionalprodukte dann auch ein Instrument für die Regionalvermarktung» begründet Standortförderer Johannes Bartels den Schritt zur regio.garantie-Auszeichnung.
Steigendes Interesse an Regionalprodukten
Das Knonauer Amt springt mit der Lancierung der Regionalmarke auf einen zukunftsträchtigen Trend auf. Die jüngste Studie «Regionalprodukte 2024» der Hochschule für Wirtschaft Zürich belegt, dass Regionalprodukte mittlerweile «die attraktivsten Mehrwertprodukte» seien und bereits 71 Prozent der Konsumenten wöchentlich Regionalprodukte kauften. «In allen Kanälen, von der Direktvermarktung über die Gastronomie und die Schnellverpflegung bis hin zu den Grossverteilern, steigt das Interesse an Regionalprodukten mit dem Label regio.garantie», so Manfred Bötsch, Präsident des Vereins Schweizer Regionalprodukte und Gastreferent des letztjährigen Frühlingstreffs der Standortförderung Knonauer Amt.

Aktuelles
Die aktuelle Ausgabe der QS World University Rankings by Subjects des internationalen Hochschulanalysten Quacquarelli Symonds (QS) bescheinigt der Schweiz abermals, dass sie bei der akademischen Ausbildung im internationalen Vergleich herausragt. Die für 2024 erhobenen Daten zu den Leistungen von 220 Fächern an 27 Schweizer Hochschulen zeigen, dass fast die Hälfte der Schweizer Studienfächer (107) in den Top 100 der Welt vertreten sind. Davon finden sich 31 Fächer in den Top 10. Das wird nur von den USA und Grossbritannien übertroffen.
Darüber hinaus weist die Schweiz 30 Einträge in den fünf weit gefassten Disziplinen Kunst & Geisteswissenschaften, Ingenieurwesen & Technologie, Lebenswissenschaften, Naturwissenschaften sowie Sozialwissenschaften & Management auf. Zum Vergleich: Deutschland hat hier 138 Einträge, Österreich 21. „Die Erfolge der Schweiz in diesem Ranking sind die Folge der internationalen Zusammenarbeit und der Betonung der Beziehung zwischen Bildung, Industrie und Unternehmertum“, wird Ben Sowter, Senior Vice President von QS, in einer Medienmitteilung zitiert.
Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ist mit 29 Fächern die stärkste Institution der Schweiz: 27 davon sind in den Top 100 und 17 in den Top 10 der Welt platziert. Wie auch in den vergangenen Jahren belegen die Fächer Erd- und Meereswissenschaften, Geologie und Geophysik weltweit Rang 1.
Die Universitäten Bern und Zürich zeichnen sich mit den Plätzen 6 und 8 besonders in der Zahnmedizin aus. Die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne ist mit den Fächern Ingenieurswesen – Elektrotechnik und Elektronik (7), Chemie (9), Ingenieurwesen – Chemie (10) und Werkstoffkunde (10) unter den Top 10 vertreten.
Bei der Ausbildung im Hotel- und Freizeitmanagement bleibt die Schweiz unangefochten führend: mit der Lausanner EHL Hospitality Business School auf Platz 1, der SHMS – Schweizerische Hotelfachschule (2), den Cesar-Ritz-Hochschulen (3), der Les Roches Global Hospitality Management Education (5), dem Hotel-Institut Montreux (6), der Kulinarischen Akademie Schweiz (7) und dem Glion-Institut für Hochschulbildung (8).
Insgesamt wurden für diese 14. Ausgabe der QS World University Rankings by Subjects 16'400 Hochschulprogramme bewertet, die von Studierenden an mehr als 1500 Universitäten an 96 Standorten weltweit in 55 akademischen Disziplinen und fünf breit gefächerten Fakultätsbereichen absolviert wurden. ce/mm

Die Hälfte der Schweizer Studienfächer ist in den weltweiten Top 100 der QS-Rangliste 2024. Die ETH liegt in drei Fächern auf Rang 1. Bild: ETH Zürich / Alessandro Della Bella
Studien
Nach einer wirtschaftlichen Abkühlung Ende 2023 schätzen die Zürcher Unternehmen die Geschäftslage und die Geschäftserwartungen wieder leicht besser ein. Im laufenden Jahr dürfte die Zürcher Wirtschaft daher ein tiefes, aber positives BIP-Wachstum verzeichnen. Auf dem Arbeitsmarkt hat sich die Dynamik in den letzten Monaten abgeschwächt: Die Arbeitslosigkeit steigt, bleibt mit 2,1% aber weiterhin tief.

Aktuelles
Die Universität Zürich (UZH) hat einen neuen Lehrstuhl für Gendermedizin geschaffen. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, ist das Ziel dieses medizinischen Zweigs, durch individuellere Diagnosen und Therapien die Genesung von Patientinnen und Patienten durch eine massgeschneiderte Medizin zu verbessern. Denn häufige Erkrankungen wie Herzleiden, Schlaganfall, Migräne, Depression oder Krebs zeigen sich bei Frauen und Männern auf unterschiedliche Art. Mit der Einrichtung eines eigenen Lehrstuhls für Gendermedizin will die UZH diesen wichtigen Bestandteil der Forschung als Präzisionsmedizin vorantreiben.
„In vielen Bereichen der Medizin war der Mann der Prototyp, deshalb wurden Krankheiten bei Frauen in der Vergangenheit erst spät oder gar nicht erkannt, weil die Diagnose vor allem auf männlichen Symptome ausgerichtet war“, wird Beatrice Beck Schimmer, UZH-Professorin und Direktorin der Universitären Medizin Zürich (UMZH), in der Mitteilung zitiert. Klinische Studien wurden generell mit Männern durchgeführt. Als Begründung wurden weibliche Hormonschwankungen, die zu inhomogenen Resultaten führen könnten, angegeben.
Nicht nur auf der Ebene der Diagnostik, sondern auch im Bereich der Forschenden und Behandelnden war die Geschlechterverteilung einseitig orientiert, der Arztberuf und die medizinische Wissenschaft der Männerwelt vorbehalten. „Wenn nur ein Geschlecht Forschung macht, engt das den Blick ein“, gibt die Medizinhistorikerin Sarah Scheidmantel an. Dies soll mit der Einführung des neue Lehrstuhls und durch den Wandel der Kultur in den grossen Spitälern und Kliniken nachhaltig geändert werden, heisst es in der Mitteilung. Erste Lehrstuhlinhaberin in Zürich ist Carolin Lerchenmüller, Professorin für Kardiologie. ce/eb

Die UZH schafft den ersten Lehrstuhl für Gendermedizin in der Schweiz, um geschlechtsspezifische Medizin zu verifizieren. Symbolbild: Mohamed_hassan/Pixabay
Aktuelles
Die UZH baut Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Datenwissenschaften aus. Dazu hat die Universität ein Institut für Mathematische Modellierung und Machine Learning (IM3L) eingerichtet. „Das neue Institut verknüpft die mathematische Forschung mit fachspezifischen Anwendungen der Datenwissenschaften“, wird Roland Sigel, Dekan der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät, in einer entsprechenden Mitteilung der UZH zitiert.
Das neue Institut wird vorläufig von Reihard Furrer geleitet. „Erst die mathematische Disziplin ermöglichte die Entwicklung neuer Werkzeuge in den Datenwissenschaften wie beispielsweise das maschinelle Lernen oder das Deep Learning“, erläutert der Direktor IM3L ad interim. Ab Herbst 2025 will das Institut den Studiengang Angewandte Mathematik und Machine Learning anbieten. Studierende sollen die nötigen Kompetenzen zur Mitgestaltung der digitalen Entwicklung der Gesellschaft erwerben. Neben Grundkonzepten von Mathematik und Programmierkenntnissen behandelt der Studiengang auch die Umformung praktischer Probleme in mathematische Modelle und ihre Analyse anhand statistischer Methoden.
Am IM3L sind bereits seit Januar 2024 vier Professuren für Netzwerkwissenschaft, Risikoanalyse, Statistik und Deep Learning verortet. Eine Übersicht über aktuelle Arbeiten dieser Professuren stellt die UZH in der Mitteilung bereit. Für die Zukunft ist die Ausdehnung auf weitere Professuren geplant. ce/hs

Am Institut für Mathematische Modellierung und Machine Learning der UZH wird mathematische Forschung mit fachspezifischen Anwendungen der Datenwissenschaften verknüpft. Symbolbild: Gerd Altmann/Pixabay
Aktuelles
Die erste Entwicklungsetappe des Innovationsparks Zürich auf dem Flugplatzareal in Dübendorf nimmt Gestalt an, informiert der Betreiber in einer Mitteilung. Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten für insgesamt sieben Neubauten auf dem Vorfeld des Areals beginnen. Die Projekte wurden aus insgesamt 28 eingereichten Vorschlägen ausgewählt, die im vergangenen Jahr bei einem global ausgeschriebenen Architekturwettbewerb eingereicht worden waren.
Die nun ausgewählten Projekte wurden von den Architekturbüros E2A, Roger Boltshauser, Mulder Zonderland und TEN aus Zürich sowie von Muoto aus Paris und 3XN aus Kopenhagen entwickelt. Nach jetzigem Planungsstand soll die Gesamtgeschossfläche zu rund 24 Prozent auf Büro- und zu 8 Prozent auf Laborflächen sowie zu 12 Prozent auf Produktionsflächen etwa für die Fertigung von Prototypen aufgeteilt werden. Weitere 36 Prozent sind als flexible Flächen für verschiedenen Nutzungen geplant. Darüber hinaus sollen Bereiche für Versorgung, Dienstleistung und forschungsnahes Wohnen entstehen. Auch Angebote für Gastronomie, Freizeit und Einkauf sind geplant.
Mit der eigenen Bebauung will der Innovationspark Zürich ein Beispiel für innovative urbane Entwicklung und Nachhaltigkeit geben. „Entsprechend werden spezielle Gebäudetypologien entwickelt, die durch ihre Flexibilität und Modularität über lange Zeiträume nachhaltig nutzbar sind und durch den Einsatz neuer Technologien einen deutlich reduzierten ökologischen Fussabdruck aufweisen“, heisst es dazu in der Mitteilung. Dafür sind unter anderem die Einrichtung eines Anergienetzes sowie grosse Solaranlagen auf Dächern und an Fassaden geplant. ce/hs

Der Innovationspark Zürich will noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten für die ersten sieben Neubauten auf dem Vorfeld beginnen. Visualisierung: Switzerland Innovation Park Zurich
Aktuelles
Die Bevölkerungsprognosen zeichnen ein Bild des Wachstums. Die Zahl der im Kanton Zürich lebenden Personen wird bis im Jahr 2030 laut Schätzungen des Statistischen Amts des Kantons Zürich um rund einen Fünftel zunehmen. Entsprechend stark wird auch die Zahl der Schulabsolventinnen und Schulabsolventen steigen. Der damit verbundene Anstieg an Jugendlichen, die eine Lehrstelle brauchen, stellt Wirtschaft, Politik und Bildung vor Herausforderungen.
Für ein ausreichendes Lehrstellenangebot sind Betriebe gefragt, die junge Leute ausbilden wollen. Dazu braucht es viel Engagement und die Bereitschaft, den Fachkräften von morgen eine Chance zu geben. Bereits heute ist man auf gutem Weg. Im Kanton Zürich machen 4 von 5 Jugendlichen eine Berufslehre. Und rund 14 000 Lehrbetriebe bieten Ausbildungsplätze an. Damit ist die Berufsbildung ein Grundpfeiler von Zürich, dem grössten Wirtschaftsstandort der Schweiz – dies soll auch in Zukunft so bleiben.
Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) engagiert sich dafür, dass die Ausbildungsbereitschaft der Lehrbetriebe weiterhin hoch bleibt und vor allem neue Lehrbetriebe dazu gewonnen werden können. Genau dort setzt das MBA mit dem Projekt «Zukunft Zürich» an.
Ziel von Zukunft Zürich ist, neue Betriebe für die Ausbildung zu gewinnen und bestehende Betriebe zu unterstützen, damit sie die Lernenden zu einem erfolgreichen Lehrabschluss führen können.

Aktuelles
Kübra Parmaksiz ist erleichtert: die Präsentation ihres Teams zum Thema «Artificial Digital Imaginations and the Human Body» ist gut gelaufen. Sie steht vor staunenden Gesichtern eines Publikums, das sich von Maturand:innen bis zum Professor für theoretische Physik erstreckt. Einen wissenschaftlichen Vortrag für eine so breite Zuhörerschaft verständlich zu machen, war noch eine der kleineren Hürde für Kübra und ihre Kolleg:innen.
Kübra hat mit ihrem Team an einem Lernangebot teilgenommen, das aktuell an der Universität Zürich (UZH) erprobt wird und ab Herbst 2024 fixer Bestandteil des Lehrangebots sein wird. Darin arbeiten Studierende problemorientiert und kooperativ an interdisziplinären Fragestellungen, die im Zusammenhang mit der digitalen Transformation stehen. Unter der Anleitung von Prof. Dr. Janna Hastings befasste sich Kübra’s Team beispielsweise damit, wie anatomische Fehler in Bildern, die mit generativer künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt wurden, qualitativ und quantitativ ausgewertet werden können. Ergebnis des Teams war ein «Score», mit dessen Hilfe verschiedene Algorithmen objektiv verglichen werden können. Zusätzlich hat das Team einen Algorithmus getestet, der mit gezieltem Training die Ergebnisse der KI-Bildgenerierung verbessern soll. Beispielsweise um Fehler wie einen ungewünschten sechsten Finger oder ein fälschlicherweise schief angesetztes Bein zu verhindern.
Projekte wie dieses verbinden Elemente einer klassischen akademischen Abschlussarbeit mit problemorientierten Herangehensweisen, die sich in der beruflichen Praxis stellen. Dabei setzen die Studierenden digitale Fähigkeiten ein, die sie in anderen Kursen erwerben können — etwa maschinelles Lernen, Open Source Intelligence, oder Blockchain-Technologien. Das beschriebene Teamwork-Setting und die erwähnten Kurse sind Teile eines neuen Studienprogramms «DSI Minor Digital Skills», welches den Masterstudierenden der Universität Zürich in Ergänzung zu ihrem Major offensteht.
Das Studienprogramm «DSI Minor Digital Skills» ist Teil der Antwort der UZH zum Umgang mit der digitalen Transformation, die klassische Bildungsinstitutionen auf allen Ebenen vor Herausforderungen stellt. Zum einen wandeln sich die technischen Möglichkeiten so rasch, dass Curricula viel flexibler anpassbar sein müssen. Weiterhin sind nicht alle Disziplinen und nicht alle Studierenden an einer Volluniversität gleichermassen technikaffin. Und schliesslich gibt es für viele Lerninhalte Ressourcen im Internet, die aktuell und hochwertig sind. Unweigerlich gelangt man zu der Frage, was die Kernaufgabe einer Präsenzuniversität in diesem Umfeld ist, und mit welchen Lehrformaten man Inhalte vermitteln kann, die das Internet nicht ohnehin bereits abdeckt.
Mit Sicherheit gehören das Erlernen von Abstraktionsvermögen, Problemlösungskompetenz, Inter- und Transdisziplinarität und Teamfähigkeit dazu. Darüber hinaus wollen wir unsere Studierenden befähigen, Entwicklungen kritisch zu analysieren und den Blickwinkel zu wechseln: die Computerlinguistin soll ein Grundverständnis von ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen von KI entwickeln, der Epidemiologe soll Algorithmen genügend gut verstehen, um deren Ergebnisse korrekt zu interpretieren. All das gelingt mit individuellen Lernpfaden, die Studierende sich entsprechend ihrer Vorbildung und Interessen zusammenstellen können. Das Studienprogramm «DSI Minor Digital Skills» ist also kein verkürztes Informatikstudium, sondern vermittelt den Studierenden umfassende Kompetenzen, welche sie in die Lage versetzt, zukünftige Veränderungen einzuordnen und positiv zu nutzen, anstatt von ihnen verunsichert oder überfordert zu sein. Die Studierenden gewinnen damit das Rüstzeug für ihre zukünftige Arbeits- und Lebensrealität.
Die Integration des Querschnitts-Angebots «DSI Minor Digital Skills» in einer disziplinär orientierten Hochschule war für uns eine Herausforderung. Glücklicherweise hat die UZH dafür zwei strukturelle Voraussetzungen: Einerseits ist die Digital Society Initiative (DSI) eine überfakultäre Lehr- und Forschungseinheit, deren interdisziplinäre Community mehrheitlich die «Digital Skills»-Kurse lehrt. Zum anderen wird das Angebot von der School for Transdisciplinary Studies (STS) organisatorisch begleitet, die genau für solche Zwecke gegründet wurde. Das alles ermöglicht, dass Kübra und ihre Kolleg:innen zu den ersten gehörten, die erfolgreich ihre Teamarbeit abschliessen konnten. Wir hoffen, dass ihnen viele Studierende folgen und sind dabei auch für Projekte mit externen Partnern offen.
Autor: Titus Neupert, Professor für theoretische Physik

Im neuen Studienprogramm DSI Minor Digital Skills lernen die Studiernden auch, zu programmieren – etwa in der Programmiersprache Python. (Bild: Unsplash / Chris Ried)
Aktuelles
Die Universität Zürich (UZH) hat beschlossen, aus dem Times Higher Education World University Ranking (THE Ranking) auszusteigen. Wie aus einer Medienmitteilung der Bildungseinrichtung hervorgeht, spiegele die Einstufung des britischen Times Higher Education-Magazins nicht die qualitativen Forschungs- und Bildungsangebote von Hochschulen und Universitäten adäquat wider. Das Ranking beziehe sich nur auf quantitative Aussagen, wie auf die Zahl von Publikationen, anstatt auf qualitative Inhalte zu fokussieren. Dies führe jedoch zu falschen Anreizen und verschiebe die Akzente einer Bewertung, heisst es in der Mitteilung. Aus diesem Grund hat sich die UZH entschlossen, keine Daten mehr an das THE Ranking zu liefern.
Wie in der Mitteilung weiter zum Ausdruck kommt, engagiere sich die UZH seit Jahren national wie international für eine offene Wissenschaftskultur. Die Universität zeigt sich überzeugt, dass die wissenschaftliche Qualität massgebend für alle forschungspolitischen Entscheide sein soll. ce/ww

Die Universität Zürich stellt inhaltliche Qualität vor Quantität; sie liefert daher keine Daten mehr für das Times Higher Education World University Ranking. Bild: Universität Zürich
Aktuelles
Balz Halter hat wie angekündigt das Präsidium des Verwaltungsrates der Limmatstadt AG niedergelegt. Auch Erika Fries, Peter Rauch und Franziska Schopp traten an der Generalversammlung am 12. März im JED Schlieren zurück. „Wir wollen Platz machen für neue Kräfte“, sagt Halter. Die Aktionäre des regionalen Standortförderers wählten einstimmig Lara Albanesi (Verwaltungsdirektorin des Kurtheaters Baden), den Weininger Gemeindepräsidenten und Weytec-Mitinhaber Mario Okle und Jasmina Ritz in den Verwaltungsrat. Sie ergänzen die Bisherigen Josef Bütler und Jörg Krummenacher. Jasmina Ritz kündigte auf Ende 2024 ihren Rücktritt als Limmatstadt-Geschäftsführerin an.
Der neue Verwaltungsrat wird sich vor allem mit der Finanzierung beschäftigen müssen. Laut Balz Halter betragen die Ausgaben rund 600‘000 Franken, ein Drittel davon für das Personal. Die Gemeinden und die beiden Kantone zahlen 200‘000 Franken, die Wirtschaft 150‘000 Franken. Die Halter AG trage den Rest mit zuletzt 250‘000 Franken. Das werde sein Unternehmen 2024 noch ein letztes Mal tun, sagte der Initiant der Limmatstadt AG.
Für die künftige Finanzierung sind sowohl die Politik als auch die Wirtschaft gefragt. „Wir brauchen eine regionale Standortförderung“, sagte die Urdorfer Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner. „Wir müssen die Finanzierung so aufteilen, dass wir die Strukturen der Limmatstadt AG erhalten können.“ Urdorf sei bereit, seinen Beitrag zu verdoppeln.
Der KMU- und Gewerbeverband Limmattal, die Vereinigung Industrie, Dienstleistungen und Handel Spreitenbach (IDH), die Wirtschaftskammer Schlieren und die Industrie- und Handelsvereinigung Dietikon unterstützen die Weiterentwicklung des regionalen Standortförderers. Es brauche eine gemeinsame Vision, einen Leistungsauftrag und ein finanzielles Commitment der neuen Trägerschaft, schreiben sie in einer parallelen Erklärung. Die Organisation solle Wirtschafts- und Standortförderung betreiben, die Region nach innen vernetzen und nach aussen vertreten.
Patrick Stäuble, IDH-Präsident und Geschäftsführer des Shoppi Tivoli, betonte die Bedeutung eines kantonsübergreifenden Angebots. „Wir brauchen eine Institution, die über Grenzen schaut. Dann ist die Wirtschaft bereit, Geld zu geben“, sagte er auf dem Podium.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zuversichtlich. „Ich habe noch kein Rezept, aber das Vertrauen, dass es weitergeht“, sagte der neugewählte Mario Okle. Josef Bütler, einer der beiden Bisherigen und früher Gemeindeammann von Spreitenbach: „Ich bin überzeugt, 2025 wird es uns noch geben.“ ce/stk

Podiumsdiskussion zur Zukunft der regionalen Standortförderung in der Limmatstadt (von links): Sandra Rottensteiner (Gemeindepräsidentin Urdorf), Patrick Stäuble (Geschäftsführer Shoppi Tivoli), David Egger (Chefredaktor der „Limmattaler Zeitung“, Moderator), Josef Bütler (Verwaltungsrat Limmatstadt AG), Albert Schweizer (Standortförderer Stadt Schlieren), Anita Martinecz Fehér (kantonale Standortförderung Zürich). Bild: zVg/Limmatstadt AG
Aktuelles
Forschende des ZHAW-Instituts für Hebammenwissenschaft und reproduktive Gesundheit haben im Rahmen der GebStart-Studie untersucht, mittels welcher Faktoren der optimale Zeitpunkt für den Spitaleintritt bestimmt werden kann. Dabei wurde ein standardisierter Fragebogen mit 15 evidenzbasierten Fragen entwickelt, die nicht nur den körperlichen Zustand, sondern eine breite Palette an Aspekten wie die emotionale Verfassung und das unterstützende Umfeld in den Blick nehmen.
Hebammen sollen den Fragebogen als Entscheidungshilfe nutzen, wenn sie Gebärenden telefonisch eine Einschätzung zur Geburtsphase geben sollen. Für gebärende Frauen sollen die Fragen als individuelle Empfehlung dienen, wann der Gang ins Spital sinnvoll ist.
„Der optimale Zeitpunkt für einen Spitaleintritt wirkt sich sowohl auf das Geburtserlebnis als auch auf die Gesundheitskosten positiv aus, weil die Interventionsraten gesenkt und der stationäre Aufenthalt verkürzt werden“, wird Susanne Grylka, Leiterin der GebStart-Studie, in einer Medienmitteilung der ZHAW zur Studie zitiert .
Der Fragebogen wurde an sechs Geburtskliniken in Zürich, Winterthur, Luzern, Basel und Baden AG mit über 600 Erstgebärenden getestet. Die Studie wurde vom Schweizerischen Nationalfonds finanziert. Am 22. März findet in Winterthur eine Abschlusskonferenz zur Studie statt. ce/js

Ein Fragebogen der ZHAW soll Hebammen helfen, den optimalen Zeitpunkt für den Spitaleintritt von Gebärenden zu bestimmen. Symbolbild: Pixabay/Cparks
Aktuelles
Seit 10 Jahren bietet die in Lutzenberg (Appenzell-Ausserrhoden) domizilierte Community verschiedene Formate für Female Founder an - darunter auch das Female Innovation Forum. Da der Verlag mit seinen Business Clubs auch jede Menge erfolgreicher und einflussreicher Frauen vereint, entstand schon vor Jahren die Idee einer eigenen Academy. Dank der Sisterhood haben nun Firmen und Persönlichkeiten zusammen gefunden, die bereit waren, die Academy mit ihrem Know-How zu unterstützen. „Es war uns noch nie wichtig, einzig und allein unsere eigenen Taschen zu füllen. Wir wollten immer in die Community re-investieren, etwas zurück geben. Und daran hat sich auch im 18. Jahr seit der Gründung von Ladies Drive nichts geändert. Immer wieder haben wir Gespräche gesucht, Ideen gewälzt, bis ein Produkt entstand, welches wir hier und heute feierlich lancieren: die Ladies Drive Founder Academy“ so Ladies Drive CEO Sandra- Stella Triebl.
Einige der erfolgreichsten Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer, VCs und Investoren, Juristinnen und HR- sowie Innovations-Coaches aber auch erfolgreiche Startup-Gründerinnen teilen in der Ladies Drive Academy ihr Wissen. Wie etwa Gina Domanig, Roland Brack, Andrea Isler, Giada Ilardo, Léa Miggiano, Tatiana Duvanskaya oder Melanie Winiger. Zu unseren strategischen Partnerinnen gehört die Anwaltskanzlei Bratschi AG (mit Elisa Aliotta, Sandra De Vito (Managing Partnerin) und dem Bratschi-Founder Academy-Team), die Transformations- und Digitalisierungsexpertinnen von emediately AG - Andrea Luder und Pia Uthmann - sowie die Agentur PRfact AG und ihre Managing Partner Mira Zawrzykraj.
Die Coaches begleiten die Gründerinnen in verschiedenen Online- und Offline-Kursen während einem Jahr. Und das kostenlos. Ab sofort können sich alle Jungunternehmerinnen, die ihr Unternehmen vor weniger als 900 Tagen gegründet haben, bewerben. Unter allen Bewerberinnen wählen die strategischen Partner-Firmen (PRfact AG, Bratschi AG und emediately AG und Ladies Drive) dann die besten 30 aus, die ab 19. April 2024 in der Academy starten dürfen. Noch nie gab es eine Academy, die kostenlos mit so geballter Community-Power all ihr Wissen weitergibt und die sich einem Ziel verschworen hat: anderen zum Erfolg zu verhelfen.
Die Jungunternehmerinnen sollen mit unserem Support ihr Unternehmen möglichst schnell aber auch möglichst erfolgreich aufbauen können. Und mit ihrem nachhaltigen Erfolg auch den Schweizer Standort stärken. „Wir lancieren diese Academy unter anderem aber auch, weil wir überzeugt sind, dass die Welt Menschen braucht, die unsere Zukunft mit Herz und Verstand prägen“ erklärt Sebastian Triebl.

Aktuelles
Die LUKS Gruppe und die ETH haben vereinbart, in der medizinischen Forschung und Lehre enger zusammenzuarbeiten. Eine von beiden Seiten unterschriebene Absichtserklärung bildet laut einer Medienmitteilung den Rahmen für eine Vielzahl von zukünftigen Kooperationsprojekten an der Schnittstelle von Medizin, Technologie und Grundlagenforschung.
Für die LUKS Gruppe bedeutet die Zusammenarbeit mit der ETH den Angaben zufolge einen privilegierten Zugang zu Technologien und wissenschaftlichen Methoden, die dazu beitragen, patientenzentrierte Forschung und datengesteuerte Medizin zu vereinen. Für die ETH sei die Zusammenarbeit mit der LUKS Gruppe und anderen Spitälern der Schlüssel zu Fortschritten in der biomedizinischen Forschung. „Wir wollen Gesundheitsversorgung und Forschung so miteinander verbinden, dass für die Patientinnen und Patienten optimale Ergebnisse erzielt werden“, wird Professor Christian Wolfrum, ETH-Vizepräsident für Forschung, zitiert.
Wie es weiter heisst, umfasse die Absichtserklärung insbesondere Forschungskooperationen auf dem Gebiet der Präzisionsonkologie, der digitalisierten Medizin und innovativer datenwissenschaftlicher Techniken, von der Pathologie bis zur medizinischen Bildgebung. Und sie werde dazu beitragen, gemeinsame Professuren in beiden Einrichtungen zu schaffen.
„Wir leisten einen entscheidenden Beitrag, um eine neue Generation von Ärztinnen, Ärzten und Forschenden zusammenzubringen“, so Professor Katrin Hoffmann, Chief Medical Officer der LUKS Gruppe. Damit sollen der Transfer in die Klinik und neue Lösungen für die Gesundheitsmedizin ermöglicht werden. ce/mm

Die LUKS Gruppe und die ETH haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um ihre Zusammenarbeit im Bereich der medizinischen Forschung und Lehre weiter auszubauen. Bild: LUKS Gruppe
Aktuelles
Big Kaiser, weltweit tätiger Hersteller von Präzisionswerkzeugen, hat einer Medienmitteilung zufolge neu das Hydrodehnspannfutter Lathe Typ B präsentiert. Es erweitert die bestehenden Spannmittel vom Typ F und R und wurde speziell für die Anforderungen von NC-Drehmaschinen (Numerical Control-Maschine) entwickelt. Damit verstärkt Bis Kaiser sein Engagement für Qualität und Innovation in der metallverarbeitenden Industrie.
Die Produktneuheit sei für den Maschinentyp von Star Micronics optimiert. Das Präzisionsspannfutter gewährleiste eine aussergewöhnliche Wiederholgenauigkeit von weniger als einem Mikrometer. Durch sein rechteckiges Design kann es mehrere Werkzeugreihen aufnehmen. Dadurch lassen sich Interferenzen minimieren und Bearbeitungsmöglichkeiten bei Platzknappheit erhöhen, was sie zu idealen Spannmitteln für die kompakt gebaute Maschinenart mache.
Typ B Hydrodehnspannfutter von Big Kaiser laufen den Angaben zufolge auf namhaften NC-Maschinenherstellern wie Citizen, Star, Tsugami und Tornos. „Sie ermöglichen einen sicheren und schnellen Werkzeugwechsel mit einem einfachen Sechskantschlüssel, was die Effizienz und Sicherheit im Betrieb erheblich verbessert“, heisst es.
„Jedes unserer Spannfutter unterliegt zwei intensiven manuellen Qualitätskontrollen, um unseren hohen Qualitätsanspruch zu gewährleisten“, wird Giampaolo Roccatello, Chief Sales & Marketing Officer für Europa, zitiert. ce/heg

Big Kaiser hat ein neues Spannsystem für den Einsatz auf NC-Drehmaschinen vorgestellt. Bild: Big Kaiser
Aktuelles
Welche Geschäfts- oder Produktideen können einen Beitrag zu einem nachhaltigeren und regenerativeren Lebensmittelsystem leisten? Diesen Fragen gehen beispielsweise Studierende in der Food Tech Summer School von ZHAW Entrepreneurship nach und tauchen dabei tief in die Welt der Proteine ein.
Der Proteinsektor steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen, die sich auf verschiedene Aspekte der Produktion, Nachhaltigkeit, Verbraucherverhalten und Technologieentwicklung auswirken. Die teilnehmenden Studierenden werden durch den Besuch verschiedener Akteure aus dem Lebensmittelsystem in die Lage versetzt, die wichtigsten Herausforderungen des Proteinsektors zu identifizieren. «Bei der Vernetzung mit wichtigen Industriepartnern der Proteinlieferkette wie Migros, Emmi oder Planted gewinnen die Studierenden wertvolle Einblicke in deren Strategien und ihr Tagesgeschäft», sagt Carmen Burri, welche die Food Tech Summer School organisiert. Aufbauend auf diesen Inspirationen entwickeln sie in interdisziplinären Teams Lösungen und präsentieren diese einer Expertenjury.
Für interessierte Studierende stehen drei Summer Schools zu den Themen Food Tech, Health Tech sowie Circular Tech zur Auswahl. Bei der Health Tech Summer School geht es um die Entwicklung neuartiger digitaler Gesundheits- und Medizingerätelösungen, während bei der Cirular Tech Summer School zirkuläre Geschäftsmodelle im Immobilien- und Bausektor im Fokus stehen. Die zwei- bis zweieinhalbwöchigen Programme der Summer Schools 2024 finden zwischen dem 8. bis 31. Juli statt und führen zu 6 ECTS-Punkten. Die Anmeldung ist bis am 1. März möglich.

Aktuelles
Mit der Eröffnung eigener Rechenzentren an drei Standorten im Grossraum Zürich im November 2022 stieg auch der Bedarf an lokalen Fachkräften bei Amazon Web Services (AWS). Der Aufbau und Betrieb der AWS-Region Europa (Zürich) unterstützt laut einer Studie durchschnittlich über 2.500 Vollzeitarbeitsplätze pro Jahr bei externen Unternehmen. In diesem Zusammenhang plant AWS Investitionen in Höhe von 5,9 Milliarden Franken bis zum Jahr 2036. Im Rahmen der weltweiten Grow Our Own Talent Initiative und zur Unterstützung der Ausbildung benötigter Fachkräfte, initiiert AWS ein Lehrlingsausbildungsprogramm in seinen Rechenzentren. Der Start ist mit zwei Berufsbildern geplant: Ab Sommer 2024 werden die Ausbildungsgänge zum/zur ICT-Fachmann/-frau EFZ und zum/zur Automatiker/in EFZ in AWS Rechenzentren beginnen. Die ICT-Fachkräfte werden Teil des Data Center Operations (DCO)-Teams, und die Automatiker werden im Data Center Engineering Operations (DCEO)-Team integriert.
Die Basislehrgänge werden in Zusammenarbeit mit unserem Ausbildungspartner Siemens durchgeführt, der in der Schweiz über ein vorbildliches Lehrlingsausbildungszentrum verfügt. AWS und Siemens sind durch eine globale Ausbildungspartnerschaft verbunden, in dem AWS Cloud-Schulungen und Siemens sein Ausbildungs-Know-how zur Verfügung stellen.
«Wir freuen uns sehr über die Ankündigung von Amazon Web Services, jungen Schulabsolventen Lehrstellen in seinen Rechenzentren im Grossraum Zürich für den Einstieg in die ICT-Industrie anzubieten. Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels, vor allem bei IT-Fachkräften, ist die Förderung und Ausbildung junger Talente für einen attraktiven Wirtschaftsstandort wichtig und wird vom Kanton Zürich sehr begrüsst.»
Fabian Streiff, Leiter Amt für Wirtschaft Kanton Zürich
Teams in AWS-Rechenzentren spezialisieren sich auf unterschiedliche Aufgabenbereiche und tragen Verantwortung für die Wartung sowie den Ausbau der kritischen Infrastruktur. Sie gewährleisten, dass die umfassende Cloud-Infrastruktur kontinuierlich effizient und sicher betrieben wird, was für Kunden jeder Grössenordnung von höchster Bedeutung ist. An drei Standorten konzentrieren sich die Teams auf folgende Hauptaufgaben:
Die hohe Sicherheit und die Einhaltung strenger Compliance-Standards sind zentral, um den Schutz und die Zuverlässigkeit für Kunden zu garantieren. Die fortlaufende Verbesserung und Wartung der Rechenzentren sichert die Cloud-Infrastruktur und schützt vor Risiken, was diese Teams zu einem unverzichtbaren Bestandteil bei der Bereitstellung von Cloud-Diensten macht.
Eine Übersicht, was es bedeutet in einem AWS Rechenzentrum zu arbeiten, findest du hier.
Die Lehrstellenausschreibungen werden auf den Webseiten des Kantons Zürich (siehe unten) sowie auf der AWS Jobseite (siehe unten) veröffentlicht. Für die 3-jährige Lehre als ICT-Fachmann/-frau können sich gute Sekundarschulabgänger der Niveaus A und B bewerben. Für die 4-jährige Lehre als Automatiker kommen Sekundarschulabgänger Niveau A und Kantonsschüler, die den beruflichen Bildungsweg einschlagen möchten, in Frage. Wichtige Anforderungen für die Bewerber sind neben Interesse an Innovation, IT und Technik gute Englischkenntnisse.
Links zur Bewerbung:
Automatike*in EFZ: Bewerbungsseite von AWS | Berufsberatung.ch
ICT-Fachmann/-frau EFZ: Bewerbungsseite von AWS | Berufsberatung.ch
AWS hat sich im Rahmen der Revision des Lehrplans 21 bei der Konzipierung neuer Cloud Module im Bereich ICT-Berufsbildung engagiert. Hierbei wurden in einer kleinen Arbeitsgruppe drei neue Module entwickelt, die den Schülerinnen und Schülern einen Einstieg in Cloud Technologien vermitteln und seit 2022 im Lehrplan verankert sind (hier ein Beispiel wie diese Module mit AWS umgesetzt werden können). Seit dem Jahr 2022 unterstützt AWS zudem die Schweizer Berufsmeisterschaften für ICT Fachleute, die erstmalig auch im Bereich “Cloud Computing” durchgeführt wurde. Als Vorbereitung hat AWS für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlose Trainings angeboten, sowie während der Durchführung der Berufsmeisterschaften den Betrieb der Wettkampfplattform sichergestellt.
«AWS Schweiz leistet einen wichtigen Beitrag zu den Schweizer ICT-Ausbildungen durch die Bereitstellung moderner Cloud-Services und dem kontinuierlichen Engagment bei der Erstellung von Lehrinhalten. Durch die Schaffung eigener Ausbildungsplätze ab Sommer 2024, leistet AWS einen direkten Beitrag zur Ausbildung von hiesigen Fachkräften, die die Schweizer Wirtschaft dringend für die digitale Transformation braucht. Wir schätzen diesen wichtigen Beitrag sehr und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit AWS.»
Matthias Bauhofer, Leiter Berufliche Grundbildung bei ICT-Berufsbildung Schweiz.
«Als Fachkundelehrer an der Technischen Berufsschule Zürich schätze ich die unkomplizierte und kollegiale Zusammenarbeit mit AWS sehr. Die umfassende Kooperation von AWS erstreckt sich nicht nur auf die technische Ebene, sondern bezieht auch die Weiterbildung von Fachkundelehrpersonen und IT-Lernenden mit ein. Diese engagierte Unterstützung ermöglicht es uns, innovative Lehrmethoden und praxisnahe, aktuelle Schulungsinhalte in den Unterricht zu integrieren. Unsere Lernenden erhalten so eine handlungsorientierte, abwechslungsreiche und topaktuelle Ausbildung. Die Zusammenarbeit mit AWS im IT-Bildungsbereich ist für mich deshalb sehr wichtig.»
Marcello Calisto, Fachlehrer Berufskunde (Informatik), TBZ Technische Berufsschule Zürich
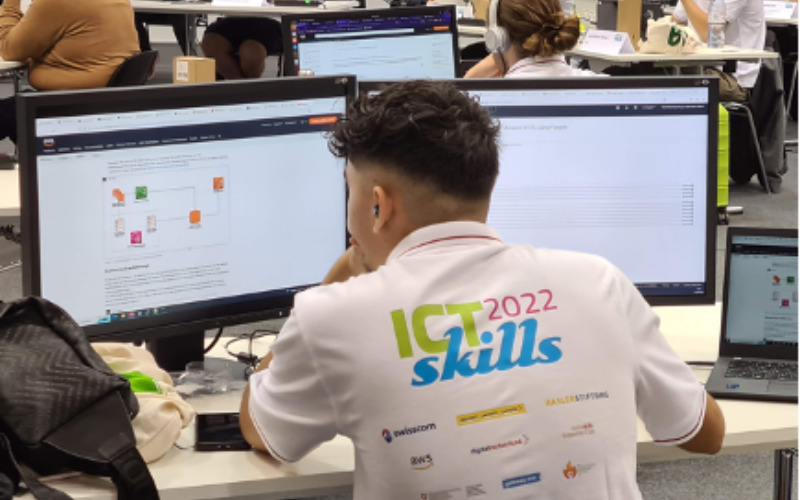
Lehrlinge an der Berufsmeisterschaften am Lösen der Cloud Computing Challenge

Lehrlinge an der Berufsmeisterschaften am Lösen der Cloud Computing Challenge

Cloud Enablement Day für Informatik-Fachlehrer (Schweizer Berufsschulen)

Techniker in einem Data Center
Aktuelles
Das auf Leuchtdioden und Halbleiter-Lichtquellen spezialisierte Schlieremer Unternehmen Exalos hat laut Medienmitteilung eine neue Generation von Hochleistungs- und Ultrabreitband-SLEDs mit Zentralwellenlängen bei 1550 Nanometern und 1600 Nanometern entwickelt. Die Leistungs-Bandbreiten-Performance lasse eine breite Palette von Anwendungen zu, einschliesslich der Faserabtastung und der Prüfung von Faserkomponenten, die die etablierten faseroptischen Kommunikationsbänder abdecken, heisst es in der Mitteilung.
Superlumineszenzdioden (SLED) stellen eine Hybridform von LEDs und Laserdioden dar. Die von Exalos auf dieser Basis entwickelten Lichtquellensysteme werden in der Medizin, in der industriellen Bilddarstellung, in Navigationssystemen, der Meteorologie und bei weiteren wissenschaftlichen Anwendungen eingesetzt.
Die Exalos AG ist im September 2023 von der kalifornischen Firma Indie Semiconductor übernommen worden. Der amerikanische Spezialist für automobile Halbleiter und Software-Plattformen zahlte den Exalos-Aktionärinnen und -Aktionären laut einer Medienmitteilung 45 Millionen Dollar in Form von Indie-Stammaktien der Klasse A. Sollten in den nächsten 24 Monaten bestimmte umsatzabhängige Leistungsziele übertroffen werden, kommen noch einmal 20 Millionen Dollar hinzu, in bar oder weiteren Aktien.
Wie es in der Mitteilung heisst, habe Exalos „mehrere hochinnovative, fortschrittliche Produkte für die anspruchsvollsten Anwendungsbereiche der Welt entwickelt und auf den Markt gebracht“. Insbesondere die praxiserprobten SLEDs für faseroptische Kreisel und die optischen Halbleiterverstärker von Exalos, die weltweit durch 59 Patente geschützt sind, ergänzten die Laser- und Silizium-Photonik-Produkte von Indie. ce/gba

Exalos hat eine neue Generation von Hochleistungs- und Ultrabreitband-SLEDs mit Zentralwellenlängen bei 1550 Nanometern und 1600 Nanometern entwickelt. Abbildung: Exalos
Aktuelles
Im Januar 2024 veröffentlichte das kantonale Amt für Wirtschaft (AWI) die Studie «Die Standortattraktivität des Kantons Zürich im Vergleich». Darin misst sich der Wirtschaftsplatz Zürich mit den fünf «Konkurrenten» München, Stockholm, Amsterdam, Dublin und London. Nun war es an der Zeit, die Studienbefunde mit möglichst vielen, möglichst gewichtigen Akteuren aus Industrie, Forschung, Verwaltung und Politik zu besprechen – am ersten «Tag des Standorts». Fabian Streiff, der Chef des Amts für Wirtschaft, erläuterte eingangs, wie gut der Kanton Zürich im internationalen Vergleich abschneidet. Sein Anspruch ist jedoch, «nicht nur täglich besser zu werden als die Konkurrenz, sondern auch besser zu werden als wir selbst tags zuvor.» Der Wirtschaftsstandort Zürich hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem attraktiven Standort für innovative und technologiegetriebene Unternehmen entwickelt, so Streiff. Gleichzeitig räumte er ein: «Punkto Kostenumfeld hinken wir anderen Standorten hinterher.»
Dem Amt für Wirtschaft war es nicht bloss ein Anliegen, Zürich mit fünf ausländischen Städten zu vergleichen, sondern auch deren Sichtweise anzuhören. So war mit Christoph Haider ein Gast aus München zugegen – einer Stadt, die etwa bei der Rekrutierung von Fachkräften grössere Mühe hat als Zürich. «Wegen der alternden Bevölkerung sind wir deutschlandweit auf Zuwanderung angewiesen», sagte der Leiter Standortmarketing München.
Der erste «Tag des Standorts» fand am 31. Januar 2024 in Zürich statt. Er wurde vom Amt für Wirtschaft (AWI) der Volkswirtschaftsdirektion organisiert. Bedeutende Zürcher Akteure aus der Industrie, dem Gesundheitsbereich, der Forschung sowie der Politik diskutierten dabei Entwicklungsthemen gemeinsam mit dem Zürcher Regierungsrat. Ziel der Veranstaltung war es, den Dialog zu fördern, Visionen und Aktionen für den Wirtschaftsstandort Zürich zu erarbeiten und Impulse zum Nutzen aller zu setzen. AWI-Amtsleiter Fabian Streiff hielt fest: «Der Fachkräftemangel ist hier genauso real.» Weil auch andere europäische Staaten bewusst im Ausland rekrutieren, müsse inländisches Potenzial möglichst gut eingesetzt werden. Überhaupt wurde der Fachkräftemangel intensiv diskutiert: Bei der folgenden Podiumsdiskussion zur Frage, wie der Wirtschafts- und Innovationsstandort Zürich weiterhin attraktiv bleiben soll, war er eines der Hauptthemen. Dazu fasste Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh pointiert zusammen: «Wer arbeiten will, den muss man arbeiten lassen!»
Podiumsteilnehmer Marc von Waldkirch, CEO von Sensorenhersteller Sensirion, nahm besonders die Politik in die Pflicht, um die Personalnot einzudämmen: «Wenn ein Antrag für eine Arbeitsbewilligung drei Monate dauert, dann ist das zu lange.» Ausländische Fachkräfte würden nicht warten, sondern in anderen Ländern anheuern. Bloss: Kann es denn schneller gehen? Der Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker hegte gewisse Zweifel: «Ich denke, anderswo dauert alles noch länger.» Ein weiteres breit diskutiertes Thema war die Unterstützung von Start-ups. Der gemeinnützige Verein SICTIC wurde eigens dafür gegründet. Deren Präsident Thomas Dübendorfer wünscht sich mehr staatliche Unterstützung: «Sobald Start-ups richtig durchstarten könnten, fehlt das Geld – oder es kommt aus dem Ausland.» Sensirion-CEO von Waldkirch warnte hingegen vor zu viel Support vom Staat: «Damit sind auch Regulierungen verbunden.»
Die zweite Podiumsdiskussion drehte sich um den Gesundheitsstandort Zürich. Erneut wurde die Rolle der öffentlichen Hand besprochen: «Der Kanton Zürich bietet grundsätzliche beste Rahmenbedingungen für eine gute Grundversorgung», sagte etwa Felix Huber, der Präsident der Ärztevereinigung MediX. «Doch vom Bund kommen immer mehr Regulierungen. Und viele davon sind gar nicht umsetzbar.» Dem stimmte auch Mazda Farshad zu. Der medizinische Spitaldirektor der Universitätsklinik Balgrist vertrat die Meinung, dass die Regulierungen ein Stück weit gar den Personalmangel befeuern. Sein Credo: «Mehr Innovation und weniger Regulation.» Alles andere würde ausländische Fachkräfte eher davon abschrecken, hierzulande zu arbeiten – genauso wie fehlende digitale Prozesse, betonte Monika Jänicke, CEO des Universitätsspitals Zürich: «Diese könnten die Mitarbeitenden massgeblich entlasten.»
Auch Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli will die Digitalisierung des Gesundheitssystems vorantreiben. Der Kanton Zürich habe diesbezüglich noch viel Arbeit vor sich: «Das elektronische Patientendossier mit digitalen Schnittstellen muss zur Norm für die datenschutzkonforme Ablage und den effizienten Austausch von Patienteninformationen werden.» Zu oft würden Ärzte viel Zeit damit vergeuden, für einen einzelnen Patienten zwischen etlichen Praxen herumzutelefonieren, ergänzt Huber. «Wirkt man dem entgegen, verbessert dies auch die Personalsituation.» Im Anschluss an die Podiumsdiskussion verteilten sich die Teilnehmenden des Anlasses auf vier Workshops und berieten intensiv über die Themen «Technologiestandort», «Fachkräftestandort», «Unternehmensstandort» sowie «Mobilität und Nachhaltigkeit». Inwiefern macht Künstliche Intelligenz den Standort Zürich attraktiver, und vor allem: Welchen Einfluss hat sie auf die Arbeitswelt, auch aus ethischer Sicht? Oder: Wie kann der Kanton Zürich im Wettbewerb mit steuergünstigeren Orten bestehen? Diese und weitere Fragen entfachten lebhafte Diskussionen.
Es war spürbar: Der Kanton Zürich steht trotz guter Ausgangslage vor grossen Herausforderungen - vor allem in Bezug auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Die interessantesten Lösungsansätze aus den Workshops werden nun von Fachgruppen weiterverfolgt und vertieft. Bevor der Netzwerk-Apéro eröffnet wurde, sprach Regierungsrätin Carmen Walker Späh zu den Gästen. Dank der Standortattraktivitäts-Studie wisse man nun, wo der Wirtschaftsstandort Zürich steht, sagte sie. Jetzt gelte es, die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Einen zweiten «Tag des Standorts» würde die Volkswirtschaftsdirektorin auf jeden Fall begrüssen: «Um zu sehen, welche Fortschritte wir gemacht haben. Lasst uns das Potenzial, das wir haben, nutzen.»

Wie bleibt der Wirtschafts- und Innovationsstandort Zürich weiterhin attraktiv? Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh und Finanzdirektor Ernst Stocker nahmen gemeinsam mit weiteren Podiumsteilnehmenden zu dieser Frage Stellung. Quelle: Tim Love Weber

Eines der zwei Panels widmete sich dem Medizinstandort Zürich. Quelle: Tim Love Weber

An den Workshops wurden mögliche Handlungsfelder diskutiert. Quelle: Tim Love Weber
Aktuelles
Forschende der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) zeichnen verantwortlich für die neue Initiative SwissChips auf dem Gebiet der Halbleitertechnik. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, ist die Initiative ins Leben gerufen worden, um eine nationale Reaktion auf EU- und USA-Förderprogramme zu liefern. SwissChips soll die nationale Forschung und Produktion ankurbeln. Vor allem soll Forschung und Innovation auf dem Gebiet von Halbleitern, Mikroelektronik und IC-Design gefördert werden.
Die Initiative ist von der ETH, dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), dem Schweizer Zentrum für Elektronik- und Mikroelektronik (CSEM) und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) gestartet worden. Sie ist zunächst auf einen Zeitraum von 2024 bis 2026 datiert. Die Kosten tragen das SBFI (26 Millionen Franken) sowie CSEM, EPFL und ETH zusammen (7,8 Millionen Franken). Christoph Studer, Leiter der Forschungsgruppe für Integrierte Informationsverarbeitung am Departement Informationstechnologie und Elektrotechnik der ETH, ist designierter Leiter von SwissChips.
Infrastruktur und Technologie der Initiative SwissChips stehen allen Schweizer Universitäten, Fachhochschulen und Forschungsinstitutionen zur Verfügung. ce/ww

Die Initiative SwissChips soll die nationale Forschung und Produktion ankurbeln. Symbolbild: axonite/Pixabay
Aktuelles
Das finnische Technologie-, Daten- und Business-Design-Unternehmen Solita erweitert seine Präsenz auf Zürich. Das neue Büro wird dort unter seiner dänischen Marke Intellishore operieren. Intellishore ist seit 2021 Teil der Solita-Unternehmensgruppe.
Laut einer Medienmitteilung wird sich das Zürcher Büro insbesondere auf die Betreuung grosser multinationaler und pharmazeutischer Unternehmen konzentrieren. Zum Managing Director der am 5. Februar 2024 gegründeten Intellishore AG wurde Mikkel Moller Andersen ernannt.
„Unsere Wachstumsstrategie zielt darauf ab, unsere Kundschaft bestmöglich zu bedienen und eine Unternehmenskultur aufzubauen, die das Wohlbefinden und die Entwicklung unserer Mitarbeitenden fördert“, wird Solita-CEO Ossi Lindroos zitiert. „Wir freuen uns, unseren Weg gemeinsam mit dem Intellishore-Team in Zürich fortzusetzen. Das Team von Solita mit seinen mehr als 2000 Fachleuten wird dafür ein starkes Rückgrat bilden.“ Die Beschäftigten sind nun in neun europäischen Ländern ansässig.
Intellishore wird in Zürich ab sofort IT-, Daten- und Pharmafachleute rekrutieren. Wie es in der Mitteilung heisst, sei die Solita-Unternehmensgruppe für ihre menschliche, nordische Arbeitskultur bekannt. Dafür hat sie unter anderem Ende 2023 bei den Women in Tech Global Awards die Auszeichnung als weltweit drittbester Arbeitsplatz für Frauen erhalten. ce/mm

Das Zürcher Büro von Intellishore wird sich vor allem auf die Betreuung grosser multinationaler und pharmazeutischer Unternehmen konzentrieren. Symbolbild: jarmoluk/Pixabay
Aktuelles
Die Schweiz ist auch in diesem Jahr mit mehreren Städten und Kantonen in den verschiedenen Top 10-Ranglisten der European Cities and Regions of the Future 2024 vertreten. Mit diesen Ranglisten bewertet fDi Intelligence – ein britisches Investmentportal, das zur „Financial Times“ gehört – die attraktivsten Standorte Europas für Direktinvestitionen. Die Daten wurden für insgesamt 330 Städte und 141 Regionen in fünf Subkategorien erhoben: wirtschaftliches Potenzial, Humankapital und Lebensqualität, Wirtschaftlichkeit sowie Verkehrsanbindung und Business-Freundlichkeit. Bei den Mikrostädten gewinnt im Gesamtranking wie im Vorjahr Zug knapp vor den irischen Städten Limerick, Galway, und Waterford und der Schweizer Stadt Lugano. In der Unterkategorie Humankapital und Lebensqualität liegt Lugano auf Platz 5, während das Wirtschaftspotenzial Luganos die Stadt auf Platz 7 positioniert. Als keine Stadt belegte Lausanne Platz 8 hinsichtlich ihres Wirtschaftspotenzials und Platz 9 in der Unterkategorie Humankapital und Lebensqualität. Unter den kleinen Städten behält Genf laut dem Bericht seine Bedeutung als eine der wichtigsten diplomatischen und finanziellen Drehscheiben der Welt und liegt somit auf Rang 3. Nach Platz 1 im Vorjahr nimmt Basel hier nun den 5. Rang ein. In der Gruppe der mittelgrossen Städte belegt Zürich im Gesamtranking nach dem ersten Platz vom Vorjahr nun Platz 2, hinter dem polnischen Breslau und vor Vilnius in Litauen. Der Bericht hebt für Zürich besonders die gut ausgebildeten Arbeitskräfte und die Konzentration an Medtech-Unternehmen hervor. In seiner Gruppe verfügt Zürich über das grösste Wirtschaftspotenzial und verzeichnete in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt 33 Neuansiedlungsprojekte. Als kleine europäische Region belegte der Kanton Waadt Platz 4 in der Unterkategorie Humankapital und Lebensqualität sowie Platz 7 in der Unterkategorie Wirtschaftspotenzial. Unter den mittelgrossen europäischen Regionen behauptet sich der Kanton Zürich auf Platz 7. Bei den kleinen Regionen belegt der Kanton Genf Platz 8 und der Kanton Zug Platz 9. Darüber hinaus waren mit Rang 3 auch die Standortförderer Greater Zurich Area (GZA) und die Basel Area mit Rang 10 erfolgreich. Sie wurden für ihre fDi-Strategie ausgezeichnet, mit der sie international expandierende Unternehmen in die Schweizer Region locken. ce/mm

Aktuelles
Unter dem neuen Namen «Founderful» wollen die Risikokapitalgeber um die Gründer Pascal Mathis, Lukas Weder und Alex Stöckl für Investitionen in Schweizer Startup-Unternehmen auflegen. Als Zielmarke streben sie ein Volumen von 120 Millionen Dollar an.
Bisher habe man bereits 85 Millionen Dollar aufgebracht und den Rest will man bis Juli 2024 zusammenbringen, wie einem Post auf Linkedin zu entnehmen ist. Die Wagniskapitalgeber wollen die Gelder insbesondere in Unternehmen investieren, die im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), Robotik und Technologie aktiv sind, wie die Nachrichtenagentur «Bloomberg» schreibt.
Laut Stöckl ist die Schweiz mit ihren Universitäten und Forschungseinrichtungen eine Drehscheibe für Startups. Etwa zwei Drittel der Portfoliounternehmen von Founderful werden von Forschern und Gründern aus Schweizer Hochschulen und Institutionen geleitet. Zu den Geldgebern des Fonds gehören Institutionen, Family Offices und Gründer von Unternehmen wie Duolingo, Delivery Hero und Scandit.
Aus dem ersten Fonds des Unternehmens, der 2020 mit rund 90 Millionen Franken aufgelegt wurde, gab es bislang zwei Exits, wie «Techcrunch» schreibt. Das waren Insightness, ein Vision-Chip-Startup, das von Sony übernommen wurde, und Bring! Labs, ein Mobile-Commerce-Startup, das von der Schweizerischen Post akquiriert wurde. In der Pipeline würden sich zwei weitere Exits befinden, beide im Bereich B2B-Software, die voraussichtlich einen zweistelligen Millionenbetrag ausmachen werden. Der Fonds hat im vergangenen Jahr acht Investitionen getätigt, darunter auch in mehrere Robotik-Startups. Die Gesamtzahl des Portfolios beträgt 48 Firmen. «Die Schweiz ist einer der am schnellsten wachsenden Risikokapitalmärkte der Welt», sagte Stöckl in einem Videointerview.

Canva
Aktuelles
Die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Kanton Zürich beruht auf dem Zusammenspiel verschiedener Elemente: Ein breitgefächertes Unternehmertum mit einer innovativen Start-Up-Szene, eine exzellente Forschungs- und Bildungslandschaft, hervorragende Infrastruktur und ein begünstigendes regulatorisches Umfeld. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Attraktivität des Standorts Zürich weiter zu stärken.
Zum Auftakt fand eine Podiumsdiskussion zum Wirtschaftsstandort Kanton Zürich statt. Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh und Finanzdirektor Ernst Stocker diskutierten mit Marc von Waldkirch, CEO Sensiron, und Thomas Dübendorfer, Präsident SICTIC, zur Frage, wie der Wirtschafts- und Innovationsstandort Zürich seine Anziehungskraft weiter verbessern kann. Das zweite Panel mit Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli, Prof. Dr. med. Mazda Farshad, Medizinischer Spitaldirektor Universitätsklinik Balgrist, Monika Jänicke, CEO Universitätsspital Zürich, und Felix Huber, Leitender Arzt mediX Praxis Zollikerberg, widmete sich dem Medizinstandort Zürich und ging der Frage nach, wie das Angebot von der Grundversorgung bis zur Spitzenmedizin weiter verbessert werden kann. Anschliessend fanden Workshops statt zu den Themen «Technologiestandort» mit Fokus auf künstliche Intelligenz; «Fachkräftestandort» mit Blick auf die Ausweitung des Talentpools; «Unternehmensstandort» mit der Leitfrage nach den Möglichkeiten zur Erhöhung der Standortattraktivität; sowie «Mobilität und Nachhaltigkeit» mit dem Ziel, aus der Digitalisierung Chancen für die Mobilität zu eruieren. Die Diskussionen in diesen Workshops resultieren in Vorschlägen für unterschiedlichste Handlungsfelder. Diese werden nun weiterverfolgt, um die Ideen in die Tat umzusetzen.
Dem «Tag des Standorts» vorausgegangen ist eine Studie zur Standortattraktivität des Kantons Zürich durch die Volkswirtschaftsdirektion. Die Analyse hat verschiedene Faktoren untersucht, die massgeblich auf den Wirtschaftsstandort Zürich wirken und aufgezeigt, wo der Kanton im Vergleich zur europäischen Konkurrenz gut dasteht (Bildung, Wirtschaftskraft, Lebensqualität) – und wo Verbesserungspotential besteht (Arbeitsmarkt, Innovation, Steuern, Infrastruktur). Der «Tag des Standorts» nutzte diese Auslegeordnung in den Diskussionen und konkretisierte den Handlungsbedarf im Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Aufgrund des grossen Interesses wird der «Tag des Standorts» nächstes Jahr erneut durchgeführt.






Aktuelles
Ein über Forschungen der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) gedrehter Film ist in der Kategorie Bester Kurzfilm beim Environmental Film and Screenplay Festival in Los Angeles ausgezeichnet worden, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.
Der Film wurde während Forschungsarbeiten im Lötschental im Kanton Wallis vom ehemaligen WSL-Zivildienstleistenden Raul Pfammatter gedreht. Der Filmproduzent mit eigener Firma, Almafilm, habe für die Dreharbeiten einige Tage die Forschenden sowie das Lötschental besucht, um „Eindrücke von der Landschaft und den Projektmitarbeitenden zu sammeln“.
Die WSL-Gruppe Dendrosciences unter Leitung von Patrick Fonti finde hier Idealbedingungen für Untersuchungen des Baumwachstums in unterschiedlichen Höhenlagen. Die Region biete wertvolles Jahrringmaterial für verschiedene Arten von dendrochronologischen Studien sowie einen perfekten Ort, um junge Forschende auszubilden. „Der Kurzfilm gibt einen tollen Einblick in unsere Arbeit und zeigt gleichzeitig die Pracht des Lötschentals. Um ihn zu promoten, haben wir ihn bei einem internationalen Wettbewerb eingereicht - und siehe da, wir haben den ersten Preis in unserer Kategorie gewonnen", wird Fonti zitiert.
Ziel der filmischen Dokumentation war es, die Forschungsarbeiten für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen, heisst es. Seit 2007 untersucht die WSL, unterstützt durch lokale Behörden und Gemeinden, die Nadelbäume im Lötschental. Aktuell werden auf Dauerbeobachtungsflächen Messdaten zum Baumwachstum entlang eines Höhengradienten erfasst. ce/heg

Ausschnitt aus dem Film von Raul Pfammatter. Bild: zVg/WSL
Aktuelles
Anfang 2023 hat der Regierungsrat beschlossen, den Kanton Zürich für Stiftungen attraktiver zu machen. Basierend auf einer Studie hat die Zürcher Regierung verschiedene Massnahmen eingeleitet, um dieses Ziel zu erreichen. Ein Kernanliegen betraf die Verbesserung der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen. Durch eine Praxisanpassung des kantonalen Steueramtes wird ein zeitgemässes und wirkungsvolles Stiftungswesen gefördert.
Neu steht einer angemessenen Entschädigung von Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten gemeinnütziger Stiftungen bei einer Steuerbefreiung nichts mehr entgegen. Zudem werden gemeinnützige Tätigkeiten im Ausland nach dem gleichen Massstab wie Tätigkeiten im Inland gemessen. Dies wird es dem Kanton Zürich vermehrt erlauben, international tätige Stiftungen im Kanton anzusiedeln.
Das Steueramt hat zudem seine Praxis zu unternehmerischen Fördermodellen publiziert. Gemäss der Praxisfestlegung des Steueramtes ist die Fördertätigkeit nicht nur auf à-fonds-perdu-Beiträge und Darlehen beschränkt, sondern es sind auf der Förderseite auch Impact Investments möglich. Voraussetzung ist, dass Stiftungen dort tätig sind, wo es noch keinen Markt gibt – sie also keine Konkurrenz für nicht steuerbefreite Investoren sind. Zudem müssen die an die Stiftung zurückfliessenden Mittel wieder für gemeinnützige Zwecke verwendet werden.
Diese Praxisanpassung erfolgt insbesondere aufgrund der geänderten gesetzlichen Grundlagen für Stiftungen, die per 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind. Gemäss Art. 84b des Zivilgesetzbuches (ZGB) müssen Stiftungen der Aufsichtsbehörde die Vergütungen des Stiftungsrates bekannt geben. Weiter hat die Aufsichtsbehörde gemäss Art. 84 Abs. 2 ZGB dafür zu sorgen, dass das Stiftungsvermögen zweckkonform verwendet wird. Erkenntnisse aus dem Austausch des Steueramtes mit den Stiftungsaufsichten des Bundes und des Kantons sowie ein Rechtsgutachten von Prof. Dr. Andrea Opel zu den steuerlichen Rahmenbedingungen für ein wirkungsvolles Stiftungswesen im Kanton Zürich stützen diese Praxisanpassung.
Die gemeinsam mit dem Verband der Schweizer Förderstiftungen «SwissFoundations» lancierte Initiative des Kantons geht aber über die Verbesserung des steuerrechtlichen Rahmens hinaus. 2023 wurden drei weitere Massnahmen umgesetzt.

Zürich revolutioniert Rahmenbedingungen, um Stiftungen anzuziehen und zu stärken, und schafft so ein zeitgemäßes und wirkungsvolles Stiftungswesen.
Aktuelles
Im schwedischen Lund entsteht mit der European Spallation Source (ESS) die weltweit stärkste Neutronenquelle. Die ZHAW School of Engineering war massgeblich an der Entwicklung der Maschinenschutz- und Personen-Sicherheitssysteme dieser Anlage beteiligt. 2025 soll die Grossforschungsanlage zum ersten Mal Spallationsneutronen generieren. Forschende versprechen sich durch den sehr intensiven und gepulsten Neutronenstrahl eine effizientere Erforschung von Materialeigenschaften. Die Anwendungen reichen von der Optimierung von Festplatten über die Untersuchung von Strukturen im Quantencomputing bis hin zur Weiterentwicklung von Solarzellen und der Aufschlüsselung von Molekülstrukturen. «Die Neutronen-Physik ist für die Erforschung der Materialstruktur sehr interessant. Neutronen durchdringen dichtere Materialien besser als zum Beispiel Röntgenstrahlen. Dadurch ermöglichen sie die Untersuchung der inneren Strukturen von Objekten», erklärt ZHAW-Forscher Christian Hilbes.
Der 600 Meter lange Protonen-Beschleuniger sowie die daran anschliessende, rotierende Neutronenquelle wurden eigens für die European Spallation Source entwickelt. Viele der Komponenten des Beschleunigers sind aufwändig realisierte Einzelanfertigungen. Wenn sich der Protonenstrahl stark ändert, können die Komponenten schneller altern oder es könnte sogar ein Loch entstehen. «Allfällige Schäden können eine lange Abschaltung der Anlage nach sich ziehen, was jeden Fall vermieden werden sollte», erklärt Christian Hilbes. Das Maschinenschutz-System soll reagieren, bevor es zu einem Schaden kommt. Dazu überwacht das System unzählige Parameter, die entlang des ganzen Beschleunigers gemessen werden. Überschreiten die Parameter festgelegte Toleranzen, wird innerhalb kürzester Zeit eine Strahlabschaltung durchgeführt. «Unsere Aufgabe bei der European Spallation Source bestand darin, die Konzepte für das Maschinenschutz-System zzz zu entwickeln sowie auch konkrete Teilsysteme davon zu realisieren. Zudem unterstützen wir bei der Entwicklung verschiedener Personensicherheits-Systeme», sagt Hilbes.
So sieht einer der über 20 Schränke mit Komponenten des Fast Beam Interlock-Systems aus, das die ZHAW entwickelt hat. Foto: Israa Ali/ESS Auf einige der Ereignisse beim Beschleuniger muss extrem schnell reagiert werden können. «Die Herausforderung war, dass es dafür kein kommerziell erhältliches Maschinenschutz-System gab, sondern wir dies von Grund auf entwickeln mussten», sagt Christian Hilbes. Daher hat das ZHAW-Team das sogenannte Fast Beam Interlock-System (FBIS) mit knapp 600 Hardware-Einheiten sowie entsprechender Software entwickelt. «Das Fast Beam Interlock-System muss Innerhalb von einigen 10 bis 100 Mikrosekunden reagieren und dies während 24 Stunden am Tag, möglichst ohne Fehlabschaltungen zu verursachen», erklärt Martin Rejzek von der ZHAW School of Engineering. «Zum Einsatz kommt das entwickelte System etwa, wenn ein Strahlstrommonitor eine unerwartete Strahlintensität misst. Dann muss es entscheiden, ob es den Strahl abschaltet oder nicht». Da die Strahlstrommonitore mit dem Fokus auf Strahloptimierung und nicht Maschinenschutz entwickelt wurden, mussten insgesamt mehrere hundert Signale von teils sehr unterschiedlichen Systemen in das Fast Beam Interlock-System integriert werden.
Auch an der Auslegung, Realisierung und bei der Nachweisführung verschiedener Personenschutz-Systeme der European Spallation Source war das Team der ZHAW massgeblich beteiligt. «Da es um Personenschutz geht, primär um den Schutz vor Strahlung, müssen für diesen Bereich sehr strenge Vorgaben eingehalten werden», erklärt ZHAW-Forscherin Joanna Weng. Dazu gehören zum Beispiel Regelungen, wann sich eine Person in welchem Bereich aufhalten darf.
2014 startete der Bau der European Spallation Source (ESS) im schwedischen Lund. Die Forschungseinrichtung ist ein Konsortium für eine europäische Forschungsinfrastruktur (ERIC), dem neben Schweden und der Schweiz elf weitere europäische Länder angehören. Aus der Schweiz ist neben der ZHAW auch das Paul-Scherrer-Institut (PSI) massgeblich am Aufbau des ESS beteiligt. Die Anlage ist zurzeit in der Inbetriebnahme. 2025 soll die Grossforschungsanlage zum ersten Mal Spallationsneutronen generieren. Wissenschaftler:innen aus vielen unterschiedlichen Forschungsbereichen versprechen sich durch den sehr intensiven und gepulsten Neutronenstrahl eine effizientere Erforschung von Materialeigenschaften.

Sicht auf das ESS-Gelände mit der Neutronenquelle und dem 600 Meter langen Protonenbeschleuniger. Foto: Perry Nordeng/Media bank | ESS (euro-peanspallationsource.se)

Unter anderem in dieser Halle, die parallel zum 600 Meter langen Beschleuniger verläuft, werden die Systeme der ZHAW eingebaut. Foto: Ulrika Hammarlund/ESS

So sieht einer der über 20 Schränke mit Komponenten des Fast Beam Interlock-Systems aus, das die ZHAW entwickelt hat. Foto: Israa Ali/ESS
Events

Aktuelles
Die ETH bietet ab dem kommenden Wintersemester einen Masterstudiengang in Weltraumwissenschaften an. Damit reagiere die bereits seit Jahren in der Weltraumforschung tätige Hochschule auf den Wunsch von Studierenden, aber auch auf die Bedürfnisse der Industrie, erläutert die ETH in einer Mitteilung. Im neuen Studiengang wird Wissen zu Raumfahrtsystemen wie Trägerraketen, Satelliten, Teleskopen und Raumfahrzeugen vermittelt. Darüber hinaus werden Grundlagen in Erd- und Planetenwissenschaften sowie in Astrophysik gelehrt.
„Der Master ist einzigartig in Europa, weil er sich sehr auf die kommerzielle Raumforschung konzentriert, konsequent interdisziplinär aufgestellt ist und zugleich das vertiefte Wissen in Ingenieurdisziplinen und Naturwissenschaften bietet, für welches die ETH bekannt ist“, wird Thomas Zurbuchen in der Mitteilung zitiert. Der ETH-Professor und ehemalige NASA-Forschungsdirektor hat den Masterstudiengang initiiert. „Die Raumfahrtindustrie braucht dringend Leute, die die komplexen Systeme überblicken und die Abhängigkeiten der Teilsysteme – vom Antrieb über die Navigation der Trägersysteme bis zu den wissenschaftlichen Experimenten – verstehen.“
Für die Umsetzung des Masters ist Simon Stähler zuständig. Der ETH-Wissenschaftler ist selbst in der Erforschung von Marsbeben aktiv. „Der Zugang zum All wird einfacher, auch für kommerzielle Akteure“, meint Stähler. So sei es bereits möglich, Platz auf einem Satelliten zu erwerben. Es werde also künftig „viel mehr Fachkräfte brauchen, die Weltraumsysteme wirklich verstehen“. ce/hs

Eine Aufnahme des James-Webb-Teleskops, in das auch Fachwissen der ETH eingeflossen ist. Bild: Bild: NASA, ESA, CSA, and STScI via Flickr
Aktuelles
Unter der Beteiligung der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) haben Forschende aus der Schweiz und Deutschland eine Möglichkeit entwickelt, das Klima- und Wettermodell ICON mit einer Open-Source-Lizenz zu versehen. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, können damit alle Interessenten und wissenschaftlich Tätigen Zugang zu dem Modell erhalten. Dies soll nicht nur die Forschung sowie die Arbeit der hinter ICON stehenden Institute transparenter machen, sondern die wissenschaftliche Entwicklung auch fördern, heisst es in der Mitteilung.
ICON (ICOsahedral Non-hydrostatic modelling framework) ist ein numerisches Wettermodell und berechnet mittels dreidimensionaler Computersimulation die Veränderung der Atmosphäre über die nächsten Stunden und Tage. Das Modell wird vor allem von nationalen Wetterdiensten wie dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) oder dem Deutschen Wetterdienst (DWD) genutzt.
Hinter der Entwicklung des ICON-Modells stehen das Schweizer Center for Climate Systems Modeling (C2SM) unter Beteiligung von Empa, MeteoSchweiz, Eidgenössischer Technischer Hochschule Zürich (ETH) und Eidgenössischer Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) aus Birmensdorf ZH sowie das Deutsche Klimarechenzentrum (DKRZ), der DWD, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sowie das Max-Planck-Institut für Meteorologie (MPI-M).
„Die Open-Source Lizenzierung wird den Austausch mit unseren Partnern in der Wissenschaft vereinfachen und könnte die Gründung neuer innovativer Startups im Umweltbereich unterstützen“, wird Dominik Brunner in der Mitteilung zitiert, Leiter der Gruppe Atmosphärische Modellierung und Fernerkundung in der Empa-Abteilung Luftfremdstoffe/Umwelttechnik. ce/ww

Klima-schädliches Methan wird etwa bei der Förderung von fossilen Energieträgern oder in der Landwirtschaft freigesetzt. Bild: zVg/Empa

Symbolbild (canva)
Aktuelles
Das Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) will Forschung und Praxis näher zusammenbringen. Zu diesem Zweck erweitert es laut einer Medienmitteilung sein Angebot: Neben der angestammten Trendforschung widmet sich die renommierte Denkfabrik mit ihrer 60-jährigen Unternehmensgeschichte neu auch den Tätigkeitsfeldern Innovationsberatung und Führungskräfteentwicklung. Diese beiden Bereiche werden von Frauen geleitet, die sich der Geschäftsleitung des GDI neu angeschlossen haben.
Als Head of Strategic Services verantwortet Susan Shaw seit dem 1. Dezember 2023 die Innovationsberatung. Die Sozialwissenschaftlerin kommt aus der Marktforschung und war zuletzt als Geschäftsführerin von GIM Suisse tätig. „Mit Strategic Services gehen wir der Frage nach, was die Erkenntnisse aus dem Think Tank für die einzelnen Branchen und Firmen sowie deren Zielgruppen bedeuten“, wird sie zitiert.
Tanja Ineichen leitet den neuen Geschäftsbereich Leadership & Transformation. Sie bringt den Angaben zufolge umfangreiche Retail-Erfahrung mit. In der Migros-Gruppe hat sie über 15 Jahre Initiativen zur Entwicklung von Führungskräften aufgebaut und geleitet. „ZukunftsgestalterInnen im Top-Management sind die treibenden Innovationskräfte im Unternehmen“, so Ineichen. Sie werden in ihrer persönlichen Entwicklung begleitet und bei der Gestaltung ihrer Teams und Organisationen unterstützt.
„Gerade in Zeiten von zunehmender Veränderungsdynamik wie heute ist sowohl die Erforschung einer möglichen Zukunft als auch die Implementierung konkreter Innovationen für die Gesellschaft und für Unternehmen umso wichtiger“, sagt CEO Johannes Bauer. „Wir erforschen die Zukunft und gestalten sie gemeinsam mit Unternehmen.“ ce/mm

Das GDI richtet sich neu aus und vereint unter seinem Dach die angestammte Trendforschung mit den ergänzenden Bereichen Innovationsberatung und Führungskräfteentwicklung. Bild: GDI
Aktuelles
Die Standortförderung Knonauer Amt und die Standortförderung des Kantons Zürich hatten am 25. Januar zu einem Vortragsabend zum Thema Künstliche Intelligenz geladen. Rund 250 Gäste seien der Einladung in den Kasinosaal in Affoltern gefolgt, schreibt die Standortförderung Knonauer Amt in einer Mitteilung. Mehr Informationen zum Vortragsabend mit dem Titel Der Roboter – Unser neuer Freund und Helfer? werden dort per Link auf einen Bericht im „Affolter Anzeiger“ zur Verfügung gestellt.
„Bei einigen Unternehmen hier im Knonauer Amt hat die KI bereits eine grosse Bedeutung“, wird Johannes Bartels im Bericht zitiert. Dem Geschäftsleiter Standortförderung Knonauer Amt zufolge bildet das Säuliamt einen „perfekten Standort“ zwischen den Wirtschaftszentren Zürich und Zug. Daher spiele auch das Thema KI in der Region eine grosse Rolle. Hier will die Standortförderung „ein gutes Ökosystem anbieten“.
Als Referierende hatten die Veranstaltenden unter anderem den Gründer und Leiter der Denkfabrik W.I.R.E., Stephan Sigrist, gewonnen. Er erläuterte Geschichte und Hintergründe der Skepsis gegenüber Künstlicher Intelligenz und riet, sich die wichtigen Entscheidungen, „zum Beispiel bei der Partnerwahl oder dem Restaurantbesuch“, nicht von einer KI diktieren zu lassen. Nathalie Klauser ging auf ethische Fragen rund um den Einsatz von KI ein. Dabei zeigte sich die Gründerin des Vereins Intersections skeptisch, dass es Künstlicher Intelligenz gelingen wird, Stereotype über Hautfarbe, Sexualität oder Geschlecht zu überwinden. ce/hs

Die Standortförderung Knonauer Amt und die Standortförderung des Kantons Zürich haben einen Vortragsabend zum Thema Künstliche Intelligenz veranstaltet. Symbolbild: geralt/Pixabay
Aktuelles
Ausländische Staatsangehörige, die unter die Bestimmungen für Drittstaatsangehörige fallen, benötigen in der Schweiz eine Arbeitsbewilligung. Ebenso wie Arbeitnehmende von Unternehmen mit Sitz in der EU/EFTA, die länger als 90 Tage pro Kalenderjahr in die Schweiz entsandt werden. Im Kanton Zürich können die Unternehmen diese Gesuche seit dieser Woche über die neue Fachapplikation workpermit.services.zh.ch einreichen. Es ist das erste digitale Angebot auf der kantonalen Transaktionsplattform ZHservices, das sich an Firmenkunden richtet. Das neue Kundenportal führt die Verantwortlichen in den Unternehmen durch den gesamten Gesuchstellungs-Prozess. Es beinhaltet den elektronischen Datenaustausch mit der im Amt für Wirtschaft zuständigen Behörde wie auch die digitale Zustellung von Verfügung und Rechnung an den Kunden.
Das bisherige System «e-Work-Permit» (eWP) war in der Volkswirtschaftsdirektion mehr als 20 Jahre lang im Einsatz. Der Bereich Arbeitsbewilligungen im Amt für Wirtschaft bearbeitete damit im langjährigen Durchschnitt rund 15'000 bis 18'000 Gesuche im Jahr. Aufgrund hoher Betriebskosten und veralteter Technologien war eine Ablösung der eWP-Fachapplikation dringend angezeigt. Die Neukonzeption wurde im Juli 2021 gestartet. Nach einer erfolgreichen Pilotphase, zu welcher ausgewählte Unternehmen beigetragen haben, konnte das neue Portal nun in Betrieb genommen werden.
Die neue Lösung entspricht den heutigen technischen Standards, ist stabil, anpassbar, erweiterbar und unterstützt den aktuellen Arbeitsalltag des Bereichs Arbeitsbewilligungen. Die neue Applikation setzt die Strategie Digitale Verwaltung des Kantons Zürich um, indem sie für die Unternehmen im Kanton Zürich, aber auch für die internen User auf der zentralen Plattform ZHservices eine zeitgemässe und benutzerfreundliche User Experience bietet. Noch in Vorbereitung befindet sich eine zusätzliche Anbindung an easyGov, den Online-Schalter des Bundes für Unternehmen. Der Kanton Zürich ist in diesem Projekt als Pilot-Kanton präsent.

Foto: Unsplash+
Aktuelles
Die Lehre an der UZH ist vielfältig, lebendig und im Wandel begriffen. Die Entwicklungsfelder sind weit gesteckt, die Horizonte offen, die Potenziale gross.
Eine sechsteilige Artikelserie auf UZH News thematisiert im Zusammenhang mit der Initiative «Zukunft der Lehre an der UZH» in den kommenden Wochen, was die Lehre bewegt, wie sie sich bewegt und wer sie bewegt. Wir werfen dazu einen Blick hinter die Kulissen der Lehrveranstaltungen und beleuchten einen Aspekt der universitären Lehre, der sonst eher selten Beachtung findet: Die Zusammenarbeit der Dozierenden untereinander und ihre Bedeutung für Innovationen in der Lehre.
Die Serie zeigt, was Dozierende veranlasst, gemeinsam über neuartige Lösungen in der Lehre nachzudenken. Sie erhellt, welche Fragestellungen, Probleme und Herausforderungen am Anfang von Innovationsprozessen stehen. Und sie erklärt, wie Dozierende zusammenarbeiten, um gute Ideen zur Reife zu bringen und in die Realität umzusetzen, und wie sie damit Entwicklungen in der gesamten Universität vorantreiben.
Für das Bild, das die Lehre nach aussen hin abgibt, fallen die kooperative Aspekte der Lehre weniger ins Gewicht als zum Beispiel die Persönlichkeit und Ausstrahlung der einzelnen Dozierenden. Die Art und Weise, wie Dozierende ihre Studierenden fordern und fördern, inspirieren und motivieren, hinterlässt prägende Eindrücke. Für den Lernerfolg der Studierenden und für ihre weitere Laufbahn ist es von grosser Bedeutung, welche Erfahrungen sie in der direkten Begegnung mit einzelnen Dozierenden machen.
Trotzdem hängt die Qualität universitärer Lehre nicht nur von der Persönlichkeit der einzelnen Dozierenden ab, sondern auch von den komplexen fachlichen, methodischen, organisatorischen, räumlichen und technischen Voraussetzungen, die meist unsichtbar bleiben. Viele Hände greifen ineinander, um funktionierende Abläufe in der Lehre zu gewährleisten. Auch Tätigkeiten wie die Aufbereitung von Lehrstoffen, das Erstellen von Lehrmaterialien, der Aufbau von didaktischem Knowhow, die Evaluation und Qualitätsentwicklung von Lehrveranstaltungen oder die Konzeption neuer Module und Studienprogramme erfolgen in arbeitsteiligen Prozessen.
Dozierende sind also keineswegs allein. Das zeigt auch der Blick auf die kollegialen Netzwerke, in denen sich die Dozierenden bewegen. Dozierende tauschen untereinander Erfahrungen aus, teilen Wissen und Knowhow und stärken damit gegenseitig ihre Handlungsfähigkeit und ihr Qualitätsbewusstsein.
Teaching-Communities sind wirkungsvolle Ideengeneratoren und Impulsgeber für die Weiterentwicklung der Lehre an der UZH.
– Gabriele Siegert, Prorektorin Lehre und Studium / Vizerektorin UZH
«Dozierenden-Netzwerke sind eine nicht zu unterschätzte Ressource für die universitäre Lehre», sagt Prorektorin Gabriele Siegert. Den einzelnen Dozierenden bieten sie fachliche Unterstützung und persönlichen Rückhalt. Für die Lehre insgesamt sind sie ein dynamischer und kreativer Faktor, wie Siegert betont: «Teaching-Communities sind wirkungsvolle Ideengeneratoren und Impulsgeber für die Weiterentwicklung der Lehre an der UZH», sagt sie.
Das sind gute Gründe, um die Vernetzung unter den Dozierenden aktiv zu fördern und deren Zusammenarbeit zu stärken. Zumal die Hochschullehre vor vielen neuen Herausforderungen steht, die man im besten Fall gemeinsam angeht. Grosse Fragen warten auf clevere Antworten. Wie lässt sich beispielsweise die steigende Nachfrage nach flexibleren, transdisziplinären und internationalen Lehrformaten befriedigen? Welche Chancen und Risiken birgt die digitale Transformation für die Lehre? Und wie sieht ein verantwortungsvoller Umgang mit generativer Künstlicher Intelligenz in Studium und Lehre aus?
Die UZH setzt bei der Weiterentwicklung der Lehre auf die Expertise, die Kreativität und das Engagement ihrer Dozierenden und ihrer Studienprogrammverantwortlichen. Mit der Initiative «Zukunft der Lehre» hat die UZH einen strategischen Orientierungsrahmen für die weitere Entwicklung der Lehre geschaffen. Dabei setzt sie einen starken Akzent auf Kooperation und auf die Vernetzung zwischen allen Personen, welche die Lehre an der UZH, sei es im Hintergrund oder im Vordergrund, ermöglichen.
Mittlerweile gibt es an der UZH zahlreiche Anlässe, Workshops und Online-Netzwerke, die fakultätsübergreifend von Dozierenden genutzt werden, um sich über aktuelle Trends, neue Ansätze oder praktische Lösungen in der Lehre auszutauschen — so zum Beispiel die Teaching Inspiration Week, der Tag der Lehre oder den Open Channel Education. Ein zukunftsweisender Schritt war auch die Gründung einer Studienverantwortlichen-Community im Frühling 2023.
Die Universitäre Lehrförderung (ULF) wiederum setzt Anreize für Dozierenden-Teams, Ideen für konkrete innovative Lehrformate zu entwickeln, zu testen und umzusetzen. Das Spektrum der Formate, die in diesem Rahmen bereits umgesetzt wurden oder derzeit entwickelt werden reicht von praktischen Tools und interne Schulungen bis hin zu ganzen Modulen oder gar Studienprogrammen. Viele der Projekte haben das Potenzial, auf die ganze UZH auszustrahlen und weiteren Entwicklungen anzuregen.
Die sechs innovativen Lehrprojekte, die für die Artikelserie auf UZH News ausgewählt wurden, stehen stellvertretend für viele weitere erfolgsversprechende Ideen, die derzeit an der UZH erprobt und umgesetzt werden. Die Auswahl orientiert sich am sogenannten «UZH Curriculum». Dieses nennt sechs Merkmale, an denen sich die Lehrentwicklung an der UZH ausrichtet. Gute Lehre ist demnach forschungsbasiert, lernzielorientiert, aktivierend, individualisiert, transdisziplinär und international.
Jedes der sechs Projekte, das in der Artikelserie vorgestellt wird, steht für eines der sechs Merkmale. Auf diese Weise – so die Hoffnung – macht die kleine Serie spürbar, wie gross die thematische und methodische Vielfalt innovativer Lehrprojekte an der UZH ist.
Startpunkt der Serie bildet ein Projekt, das für individualisierte Lehre steht, also darauf abzielt, den Studierenden die selbständige Vertiefung des Unterrichtsstoffes zu ermöglichen. Dozierende, die solche Lernumgebungen für ihre jeweiligen Zwecke anpassen und zielführend nutzen wollen, müssen sich einiges an Spezialwissen aneignen. Um individualisierte Lehrangebote universitätsweit zu verbreiten, ist deshalb der Knowhowtransfer unter Dozierenden wichtig. Das Projekt «Digitales Selbstlernen» unterstützt Dozierende aller Fakultäten dabei, massgeschneiderte Lernumgebungen für ihre Studierende aufzubauen.
Mehr dazu lesen Sie im ersten Teil der Serie.

Aktuelles
Bildung ist der wichtigste Rohstoff der Schweiz und die Basis ihres heutigen und künftigen Erfolgs. Studierende der ETH Zürich stellten ihr Wissen 2023 erneut in der Praxis unter Beweis: Mit einem selbstgebauten Elektro-Rennwagen brachen sie den bisherigen Beschleunigungsweltrekord. In nur 0,956 Sekunden beschleunigte der ETH-Bolide Mythen von 0 auf 100 km/h. Ein anderes Studierendenteam war mehr als 3000 Kilometer in ihrem selbstgebauten Solarauto unterwegs. Die Studierenden schafften es an der World Solar Challenge nach sechs Tagen in der brütenden Hitze des australischen Outbacks ins Ziel.
Doch die Studierenden und Forschenden bauen nicht nur Autos: Mit Drohnen sammelten sie im Regenwald DNA-Spuren von Lebewesen und identifizierten damit zahlreiche Pflanzen- und Tierarten. Ihre Technologie war so überzeugend, dass sie ins Finale des Wettbewerbs XPRIZE Rainforest einzogen.
Auch die Para-Athletin Flurina Rigling will an einem prestigeträchtigen Wettbewerb teilnehmen – den Paralympics 2024 in Paris. ETH-Student Luca Hasler hat ihr dafür einen neuen massgeschneiderten Velolenker gebaut. Rigling verspricht sich davon mehr Sicherheit, Komfort und vor allem schnellere Zeiten.
Die ETH Zürich trägt mit dem Transfer von Wissen und Technologien stark zur Innovationskraft und zum Wohlstand der Schweiz bei. Auch in diesem Jahr beteiligte sie sich an der Gründung zahlreicher Start-ups wie zum Beispiel aiEndoscopic. Dieses ETH-Spin-off hat ein Gerät gebaut, das mittels Robotik und künstlicher Intelligenz Intubationen zur künstlichen Beatmung einfacher und sicherer macht.
Ausserdem entwickelten ETH-Forschende 2023 eine Reihe von Technologien, die der Gesellschaft und der Wirtschaft nützen: zum Beispiel ein neues Korrosionsschutzmaterial für Bauwerke und Fahrzeuge, das sich selbst repariert und wiederverwendbar ist; eine smarte Laufhose, die mit einem Textilsensor die Müdigkeit der Sportler:innen während körperlicher Anstrengung erkennt; ein neues Erdbebenrisikomodell, das zeigt, wo sich Erdbeben wie auf Menschen und Gebäude auswirken; oder einen Brandsimulator, mit dem Holzbauteile unter realistischen Bedingungen getestet werden können.
Unter Leitung der ETH Zürich zeigte ein Konsortium aus Wissenschaft und Industrie zudem, dass es machbar ist, CO2 aus der Atmosphäre abzuscheiden und in recycliertem Beton oder in Gestein zu speichern. Und schliesslich lancierte die ETH Zürich zusammen mit der EPFL eine grüne Energie-Koalition, um Lösungen die Speicherung und den Transport erneuerbarer Energieträger voranzutreiben, sowie die Swiss-AI-Initiative. Deren Ziel ist es, die Schweiz als führenden Standort für transparente und vertrauenswürdige künstliche Intelligenz zu positionieren.
Die Zusammenarbeit über die Grenzen der Forschungsdisziplinen hinweg sowie mit nationalen und internationalen Partnern befruchtet die Suche nach Lösungen für die Probleme von heute und morgen. So haben die ETH Zürich und die Uno 2023 den Start einer Partnerschaft besiegelt. ETH-Forschende werden ihre Expertise künftig verstärkt der internationalen Organisation zur Verfügung stellen, unter anderem in den Bereichen Konfliktforschung, Entwicklungszusammenarbeit und Ernährungssicherheit. Und dank einer grossen Donation der Dieter-Schwarz-Stiftung plant die ETH Zürich einen neuen Lehr- und Forschungsstandort in Heilbronn. In den nächsten 30 Jahren sollen 20 neue Professuren geschaffen werden.
Im Bereich der medizinischen Forschung entwickelten Wissenschaftler:innen der ETH und des Universitätsspitals Zürich ein vollautomatisches Testverfahren für das Multiple Myelom, einer Form von Blutkrebs. Damit untersuchen sie, von welcher Behandlungsoption Patientinnen am meisten profitieren. Und ETH-Materialforschende arbeiteten mit Kolleg:innen der Technischen Universität Nanyang in Singapur zusammen. Sie wollen in Zukunft Hühnerfedern nutzen, um eine Membran für Brennstoffzellen herzustellen. Damit lässt sich Strom produzieren.
Die ETH Zürich wird ihre Weltraumforschung und die Zusammenarbeit mit der Raumfahrtindustrie ausbauen sowie einen neuen interdisziplinären Masterstudiengang Weltraumwissenschaft und - technologie lancieren. Als Leiter der Initiative ETH Space konnte Thomas Zurbuchen, der ehemalige Wissenschaftsdirektor der Nasa, gewonnen werden. Gemeinsam mit Partnern der Raumfahrtindustrie forschen Wissenschaftler:innen der ETH bereits heute an einer Breitband-Internetkommunikation via Laser und Satellit.
Die ETH Zürich ist auch in der Grundlagenforschung stark. 2023 haben etliche Studien Aufsehen erregt, das Wissen erweitert und das Fundament für künftige Entdeckungen gelegt.
So wiesen ETH-Forschende nach, dass die Kruste des Mars doppelt so dick ist wie die der Erde. Andere Wissenschaftler:innen halten es für plausibel, dass Harnsäure bei der Entstehung des Lebens eine wichtige Rolle spielte. Ausserdem fanden zwei Forschungsteams Hinweise darauf, dass sich der Klimawandel selbst verstärkt: Auf einer wärmeren und trockeneren Erde werden Mikroorganismen des Bodens wesentlich mehr CO2 produzieren und in die Atmosphäre abgeben als heute. Gleichzeitig werden die Pflanzen der tropischen Regenwälder deutlich weniger CO2 aufnehmen.
Nicht nur lebendig, sondern gleichzeitig auch tot, können Überlagerungszustände in der Quantenphysik sein, die als Schrödinger-Katze bezeichnet werden. Die schwerste Schrödinger-Katze stammt seit diesem Jahr von Forschenden der ETH.
Ums Überleben geht es bei den Bakterien: Biomediziner:innen klärten, warum verschiedene Stämme von Salmonellen den menschlichen Darm besiedeln können. Sie tauschen dabei Erbinformation aus, die sie resistent gegenüber Antibiotika machen. Schliesslich entwickelten Bioingenieur:innen Designerzellen, die dereinst Diabetiker:innen mit Insulin versorgen könnten. Als Signal für die Insulinausschüttung dient diesen Zellen Rockmusik.

Von Drohnen, die DNA sammeln, über die Marskruste bis hin zur Breitband-Internetkommunikation per Laser: An der ETH Zürich wird 2023 viel geforscht und entwickelt. (Bild: Josef Kuster / ETH Zürich)
Aktuelles
Die Stadt Dietikon hat der Phänomena 2025 die Baubewilligung am 30. Oktober erteilt und das Vorhaben dann öffentlich zur Einsicht aufgelegt. In den nachfolgenden Wochen ist laut einer Medienmitteilung der Phänomena keine Einsprache eingegangen. Damit kann das Bauvorhaben ab 2024 umgesetzt werden. Die wissenschaftliche Erlebniswelt in Dietikon war ursprünglich für 2024 geplant gewesen, wurde aber um ein Jahr verschoben. Die „Erlebniswelt zum Staunen“ soll nun vom 11. April bis zum 19. Oktober 2025 stattfinden, wie geplant im Niderfeld in Dietikon.
„Endlich können wir mit den definitiven Bauvorbereitungen und anschliessend im Frühjahr mit der Bauinstallation starten“, wird Urs Müller zitiert, Gesamtleiter der Phänomena. Die Zugänge zum Areal und der Busparkplatz seien bereits angelegt.
Der Stadtpräsidenten von Dietikon, Roger Bachmann, äussert sich erfreut darüber, dass es keine Einwendungen gegeben hat. „Die Phänomena ist wichtig für das moderne Dietikon und die Unterstützung der Bevölkerung zeigt, dass die Menschen hinter der grössten Schweizer Erlebniswelt stehen“, wird Bachmann zitiert.
Die erste Phänomena fand 1984 am Zürichhorn statt und wurde von über 1 Million Menschen besucht. Die Organisierenden rechnen für die zweite Auflage mit einer ähnlich grossen Zahl an Besuchenden. Die Ausstellung wird ausser von der Standortgemeinde Dietikon von den Kantonen Aargau und Zürich und von zahlreichen Partnern unterstützt. Zu den neusten Unterstützern gehören der Aktionsplan Holz des Bundesamts für Umwelt und der Schweizerische Nationalfonds (SNF). Im Patronat der Phänomena 2025 sind neu Nationalrätin Regine Sauter, Nationalrat Andri Silberschmidt und Professor Matthias Egger, der Präsident des Nationalen Forschungsrats des SNF. ce/gba

Die Phänomena soll vom 11. April bis zum 19. Oktober 2025 in Dietikon stattfinden. Visualisierung: Phänomena
Aktuelles
Klimawandel, geopolitische Instabilitäten, Energiekrise, Unterbrechungen von Lieferketten, Cyberangriffe, die sich rasch verändernde Arbeitswelt: Die Gesellschaft steht vor zahlreichen globalen Herausforderungen. «Einer der Schlüssel für Lösungen liegt in der digitalen Transformation. Alle Kräfte sind gefordert – insbesondere Wissenschaft und Universitäten. Diese tragen eine besondere Verantwortung, ihren Beitrag zu leisten», erklärt ETH-Präsident Joël Mesot die Motivation für diese Partnerschaft.
Um die digitale Transformation in verantwortungsvoller Weise mitzugestalten, haben die gemeinnützige Dieter Schwarz Stiftung und die ETH Zürich heute eine weitreichende Absichtserklärung unterschrieben. In den kommenden 30 Jahren sollen mit Zuwendungen der Stiftung schrittweise rund 20 Professuren aufgebaut werden.
Präsident Joël Mesot zeigt sich hocherfreut: «Die Partnerschaft mit der Dieter Schwarz Stiftung erlaubt es der ETH Zürich, ihre Forschung und Lehre insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz in einem Ausmass weiterzuentwickeln, das im Rahmen von regulären ETH-Mitteln und -Strukturen nicht möglich wäre.» Gleichzeitig sei das der Start für eine Zusammenarbeit von europaweiter Bedeutung. Dank der zusätzlichen Professuren kann die ETH Zürich den strategischen Bereich Digitale Transformation und Datenwissenschaft markant ausbauen.
In einem konkreten ersten Schritt werden in Zürich zwei neue Professuren im Bereich Informatik und Datenwissenschaften eingerichtet und das Zurich Information Security and Privacy Center (ZISC) weiterentwickelt. Zusätzlich wird bei der ETH Foundation ein Stiftungsfonds geschaffen, der dazu dient, die Partnerschaft langfristig zu etablieren und Investitionen in die Infrastruktur in Zürich zu tätigen.
Von den weiteren Professuren soll mehr als die Hälfte auf dem von der Dieter Schwarz Stiftung ins Leben gerufenen Bildungscampus in Heilbronn angesiedelt sein. Dort will die ETH Zürich ein neues Lehr- und Forschungszentrum und damit ihren zweiten Ableger im Ausland eröffnen.
«Diese Donation ist eine «Win-win-Situation» für Deutschland ebenso wie für die Schweiz und stärkt die traditionell enge Forschungszusammenarbeit der beiden Länder», sagt ETH-Präsident Mesot. Die ETH Zürich helfe, in Heilbronn einen internationalen Forschungs- und Bildungshub im Bereich der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz aufzubauen. Dort soll nicht nur geforscht, sondern es sollen auch neue Lehrangebote entwickelt werden – von Weiterbildungsprogrammen bis hin zu Studiengängen. Im Gegenzug fliesst ein guter Teil der Zuwendungen direkt in Forschung, Lehre sowie in die Infrastruktur in Zürich. Die in Deutschland stationierten ETH-Forschenden werden sowohl in Heilbronn wie auch in Zürich unterrichten. Auch auf Forschungsebene ist ein enger Austausch zwischen beiden Standorten vorgesehen. «Die gemeinsame Forschung und gemeinsam generiertes Wissen kommt der Schweiz, Deutschland, Europa und letztlich der ganzen Welt zugute», betont Mesot.
Im Zentrum stehen Themen wie Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Bioinformatik oder die Kreislaufwirtschaft. «In diesen Bereichen braucht es die internationale Zusammenarbeit mehr denn je», betont Mesot. Genau diese Vernetzung sei das Ziel des Bildungscampus in Heilbronn. Die ETH Zürich kann von den positiven Erfahrungen in Singapur profitieren, wo sie seit 2010 ein Forschungszentrum in Nachbarschaft zu führenden Universitäten der Welt betreibt.
«Es freut uns sehr, dass nach der renommierten Technischen Universität München nun mit der ETH Zürich eine weitere internationale Spitzenuniversität das Ökosystem in Heilbronn stärken wird. Wir brauchen einen Zusammenschluss der besten wissenschaftlichen Kräfte», sagt Reinhold Geilsdörfer, Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung.
Die Dieter Schwarz Stiftung arbeitet daran, weitere Professorinnen und Professoren von Top-Universitäten für eine Zusammenarbeit auf dem Bildungscampus zu gewinnen. Mit Niederlassungen präsent sind die Technische Universität München (TUM) und die Fraunhofer-Gesellschaft. Mit den Universitäten Oxford und Stanford, dem HEC Paris, der Hebrew University Jerusalem sowie der Nanyang Technological University Singapore unterhält die Dieter Schwarz Stiftung weitere strategische Partnerschaften.
Wie das ETH-Zentrum in Heilbronn konkret ausgestaltet sein wird, welche Forschungs- und Lehrschwerpunkte die ETH Zürich dort setzen wird und wie die Zusammenarbeit zwischen Zürich und Heilbronn aussehen wird, wird in den kommenden Monaten ETH-intern erarbeitet. Läuft alles nach Plan, werden die Dieter Schwarz Stiftung und die ETH Zürich bereits im nächsten Jahr einen weiteren Vertrag unterschreiben, der die Berufung der fünf ersten Professuren für den Bildungscampus in Heilbronn erlaubt.

(Bild: ETH Zürich / Gian Marco Castelberg)

ETH-Präsident Joël Mesot (links) und Reinhold Geilsdörfer, Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung, haben heute die gemeinsame Absichtserklärung unterschrieben. (Bild: Valeriano Di Domenico)

So soll der Bildungscampus in Heilbronn aussehen. (Bild: pesch partner / Topotek 1)
Aktuelles
Die Schlieremer Standortförderung schaut auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Am 30. November waren in der Stadt 1319 juristische Personen angesiedelt, ein neuer Rekord. Laut einer Mitteilung der Standortförderung wird die Mehrheit der neuen Unternehmen noch immer von den bisherigen Clustern angezogen. Dazu gehören vor allem der Bio-Technopark mit seiner nationalen und internationalen Ausstrahlung, aber auch der Healthtechpark und das Start-up-Cluster.
Künftig will die Stadt ihre Attraktivität auch im KMU- und Gewerbeumfeld erhöhen. Im September wurde dafür der Arealausschuss Schlieren Nord-Ost gegründet. Ihm gehören 25 Immobilieneigentümer des Areals entlang der Rütistrasse an. Schon heute sind dort über 80 Unternehmen mit rund 900 Arbeitsplätzen tätig. Künftig soll Schlieren Nord-Ost zu einer Marke in KMU und Gewerbe entwickelt werden.
Das zeigt bereits Wirkung. „Schon bei den zahlreichen Wirtschafts- und Gewerbeevents am Schlierefäscht sind mir neue Firmen aufgefallen, die sich direkt ums Netzwerk in Schlieren kümmerten“, wird Standortförderer Albert Schweizer in der Mitteilung zitiert. Schweizer war als Mitglied des OK Schlierefäscht für das Sponsoring verantwortlich. ce/stk

Das Areal Rütistrasse soll unter dem Namen Schlieren Nord-Ost zu einer Marke im Wirtschafts- und Gewerbeumfeld werden. Bild: zVg/Stadt Schlieren
Aktuelles
«Wir freuen uns und sind stolz über diese tolle Platzierung im Ranking. Dies ist ein Ergebnis unseres Engagements und einer hohen Qualität der Lehre, Weiterbildung und Forschung. Ich danke allen, die hierzu beigetragen haben.»
– Reto Steiner, Direktor der School of Management and Law

Aktuelles
Der Standort Irchel wird in den kommenden 25 Jahren grundlegend modernisiert, verdichtet und ausgebaut. Eine Schlüsselrolle spielt dabei das geplante «PORTAL UZH». Zum einen ermöglicht dieser Neubau, die Campustechnik und -logistik zu erneuern, zum anderen stellt er weitere notwendige Flächen für Lehre und Forschung zur Verfügung.
Vor rund einem Jahr hat die Baudirektion des Kantons Zürich – im Auftrag der Universität Zürich und der Bildungsdirektion des Kantons Zürich – den Projektwettbewerb für das «PORTAL UZH» ausgeschrieben. Nun ist das Siegerprojekt auserkoren: Die Arbeitsgemeinschaft EM2N Architekten und Jaeger Baumanagement aus Zürich gewinnt den Wettbewerb. Insgesamt nahmen 14 Teams teil.
Das Siegerprojekt fügt sich sehr gut in die Gesamtanlage auf dem Irchel ein – gemäss Jury führt es die «DNA des Campus Irchel» weiter. «Das Projekt von EM2N und Jäger Baumanagement zeichnet sich durch seine herausragenden inneren Qualitäten und die gelungene Integration in den bestehenden Irchel-Campus aus. Das Team hat die Anliegen der Universität Zürich nicht nur verstanden, sondern sie integral noch einen Schritt besser aufgenommen», sagt François Chapuis, Direktor Immobilien und Betrieb.
Der geplante Holz-Beton-Hybridbau besteht aus einem sechsgeschossigen Bau und einem langen Labortrakt, der ein Geschoss niedriger ist. Ein einladender Eingangsbereich mit begrünter Dachterrasse verbindet die beiden Bereiche. Im vorderen Bau an der Magistrale befinden sich Hörsäle, Seminarräume sowie Lehr- und Arbeitsplätze für Studierende, Forschende und Mitarbeitende verschiedener Services. Der direkt anschliessende Labortrakt enthält neben den Laboren auch Büro- und Begegnungszonen. Auf den Dächern wird eine Photovoltaikanlage installiert. Im Untergeschoss des Neubaus werden Technik- und Logistikanlagen für den gesamten Campus eingebaut. Sie ersetzen die veralteten Anlagen und versorgen künftig den ganzen Campus Irchel mit Wärme, Kälte, Licht, Luft und Wasser sowie mit Logistikdienstleistungen.
Das Siegerprojekt wird nun weiterentwickelt. Ziel ist es, dem Regierungsrat und dem Kantonsrat im Jahr 2025 ein bewilligungsfähiges Bauprojekt vorzulegen. Wenn diese dem Projekt zustimmen und keine Rekurse erfolgen, können die Bauarbeiten voraussichtlich 2029/2030 beginnen.

Blick auf das neue PORTAL UZH von der Magistrale aus. (Visualisierung: EM2N)

Atriumhalle im neuen PORTAL UZH (Visualisierung: EM2N)

Hörsaalzone (Visualisierung: EM2N)

Laborzone (Visualisierung: EM2N)

Balkonzone (Visualisierung: EM2N)
Aktuelles
Die League of European Research Universities (LERU) setzt sich für die Förderung der Grundlagenforschung an europäischen Universitäten ein. Ihr Ziel ist es, das Bewusstsein von politischen Entscheidungsträgern und Meinungsbildnern für die bedeutsame Rolle von Forschungsuniversitäten zu stärken. Sie äussert sich regelmäßig zur Forschungs-, Innovations- und Bildungspolitik der EU.
Aktuell umfasst die LERU 23 Mitglieder – darunter die Universitäten Zürich und Genf in der Schweiz, aber auch die britischen Universitäten Oxford und Cambridge. Ab dem 1. Januar 2024 tritt die ETH Zürich auf Einladung der LERU als 24. Mitglied bei.
Dazu Linda Doyle, LERU-Vorsitzende und Prorektorin des Trinity College Dublin: "Ich freue mich, dass mit der ETH Zürich eine der führenden Forschungsuniversitäten dem LERU-Netzwerk beitritt. LERU spielt eine wirklich wichtige Rolle, wenn es darum geht, sich für Forschung, Innovation und Bildung in ganz Europa und darüber hinaus einzusetzen. Mit der ETH Zürich werden wir bei der Verwirklichung unserer gemeinsamen Ambitionen noch stärker sein."
«Gemeinsam mit gleichgesinnten Hochschulen möchte die ETH Zürich der Gesellschaft dienen und die europäische Wissenschaftslandschaft stärken. Die LERU steht für Werte, die wir teilen. Sie ist eine wichtige Stimme für Forschung und Bildung in Europa», sagt ETH-Präsident Joël Mesot.
Der Beitritt der ETH Zürich erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Hochschule weiterhin vom Europäischen Forschungsprogramm Horizon Europe ausgeschlossen ist. Für die ETH ist es daher wichtiger denn je, sich stärker mit Partneruniversitäten in Europa zusammenzuschließen.

(Bild: ETH Zürich / Gian Marco Castelberg)
Events

Aktuelles
Am Bahnhof Wallisellen ist die „grösste vollautomatische Veloparkanlage der Schweiz" in Betrieb gegangen. Der Veloparkturm erweitert das schweizweite Netzwerk des Dübendorfer Unternehmens V-Locker und umfasst laut einer Mitteilung 30 individuelle Abstellboxen. Mit der Parklösung sollen Autofahrten zum Bahnhof verringert werden.
Wie aus der Mitteilung hervorgeht, können Pendlerinnen, Pendler und Kurzzeitparkierende ihre Velos in den komfortablen und sicheren Abstellboxen in einer platzsparenden Turmkonstruktion unterstellen. Die Boxen seien ausschliesslich über eine App und rund um die Uhr buchbar. Damit entspreche der Parkturm „dem Zeitgeist des (E-)Bike-Booms“.
Die Gemeinde sieht in der Verfügbarkeit von zusätzlichen Veloparkplätzen einen Beitrag zur Velo-Mobilität. „Die bereits etablierte Parklösung bietet ein attraktives Angebot“, heisst es.
Der Hersteller weist auf Innovationen wie das mehrfache Öffnen und Teilen einer Box mit weiteren Nutzenden hin. Zudem seien die Boxen auch für die Cargo-E-Bikes von Monopole nutzbar. Um das Konzept auszuprobieren, seien 20 Parkstunden über einen Code aktivierbar.
V-Locker kündigt eine weitere Station am Bahnhof Grenchen SO an, die ab Mai 2024 zur Verfügung stehen soll. ce/heg

V-Locker hat am Bahnhof Wallisellen einen Veloparkturm eröffnet. Bild: zVg/V-Locker
Aktuelles
Forschende der Universität Zürich (UZH) beteiligen sich an dem europäischen Projekt Happy Mums, das unter der Leitung der Universität Mailand geführt wird. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, nehmen von Seiten der UZH die Forschungsgruppen des Phamakologen Urs Meyer und der Pharmakologin Juliet Richetto sowie die Gruppe der Neuro-Epigenetikerin Isabel Mansuy teil. Insgesamt beteiligen sich an dem Horizon-Europe-Projekt 17 Universitäten und Organisationen.
Gegenstand der umfassenden Studie ist nicht nur, manifeste Depressionen von Stimmungsschwankungen in der Schwangerschaft unterscheiden zu können. Es sollen auch Behandlungsmethoden gefunden werden, die das Wohl depressiver werdender Mütter bessern, ohne dem werdenden Leben zu schaden. Bislang gibt es zu geringe Erkenntnisse darüber, wie sich Substanzen wie Antidepressiva auf den Fötus auswirken. Das Projekt Happy Mums soll dazu beitragen, biologische und mikrobiologische Prozesse, die in der Schwangerschaft ablaufen, ebenso zu erkunden wie psychische Prozesse während dieser Zeit.
„Damit wir diese komplexen Zusammenhänge aufdröseln können, kombinieren wir eine Vielzahl von Daten aus der klinischen und präklinischen Forschung“, wird Juliet Richetto, Pharmakologin an der UZH, in der Mitteilung zitiert.
Um eine grosse Datenmenge zu erhalten, begleitet Happy Mums tausend Mütter und Kinder während der Schwangerschaft und nach der Geburt. Dabei werden vielzählige paraklinische Werte wie Blutwerte und Hormonspiegel ebenso erhoben wie genetische Daten. Bildgebende Verfahren ergänzen das Diagnosespektrum.
Das internationale Projekt läuft bis 2026. Von den Studienresultaten erhoffen sich die Forschenden, die psychische Gesundheit von Müttern und Kindern dauerhaft zu bessern. ce/eb

UZH-Forschendeuntersuchen biologische Ursachen und Wirkungen von Depressionen in der Schwangerschaft. Symbolbild: Cparks/Pixabay
Aktuelles
Vantage Data Centers errichtet seinen 33. Campus weltweit in Glattfelden. Das Zürich 2 genannte Rechenzentrum soll laut einer Medienmitteilung in diesem Sommer eröffnet werden. Es liegt rund 20 Kilometer von dem im Dezember 2021 in Betrieb genommenen Rechenzentrum Zürich 1 in Winterthur entfernt. Auf dem dortigen 3,7 Hektaren grossen Flaggschiff-Campus hatte das weltweit tätige Unternehmen mit Hauptsitz in Denver im US-Bundesstaat Colorado und Sitzen für die EMEA-Region in Luxemburg und London die Errichtung von drei Rechenzentren mit insgesamt 40 Megawatt IT-Leistung angekündigt.
Der „hochsichere und carrierneutrale“ Campus Zürich 2 wird auf 21'000 Quadratmetern 24 Megawatt IT-Kapazität bereitstellen. Zur Kundschaft von Vantage zählen sogenannte Hyperscaler, Cloud-Anbieter und Grossunternehmen.
Den Angaben zufolge wird Zürich 2 über „branchenweit führende Kennzahlen“ für die Verbrauchseffektivität von Strom und Wasser verfügen. Die Abwärme soll mittels Wärmepumpen zur Klimatisierung der Büros und zur Verringerung des externen Energieverbrauchs verwendet werden. Ausserdem werde ein nahegelegenes Hotel und Seminarzentrum damit versorgt.
Zudem sei eine Regenwasserversickerung und ein begrüntes Dach vorgesehen. Die Holzfassade soll sich harmonisch in das Erscheinungsbild der Gemeinde einfügen. Vantage wird eigenen Angaben zufolge während der Hauptbauzeit etwa 400 Personen beschäftigen und etwa 25 Dauerarbeitsplätze für den Betrieb des Rechenzentrums schaffen. ce/mm

Vantage Data Centers investiert mehr als 370 Millionen Franken in sein zweites Schweizer Hyperscale-Rechenzentrum. Bild: Business Wire
Events

Events

Events
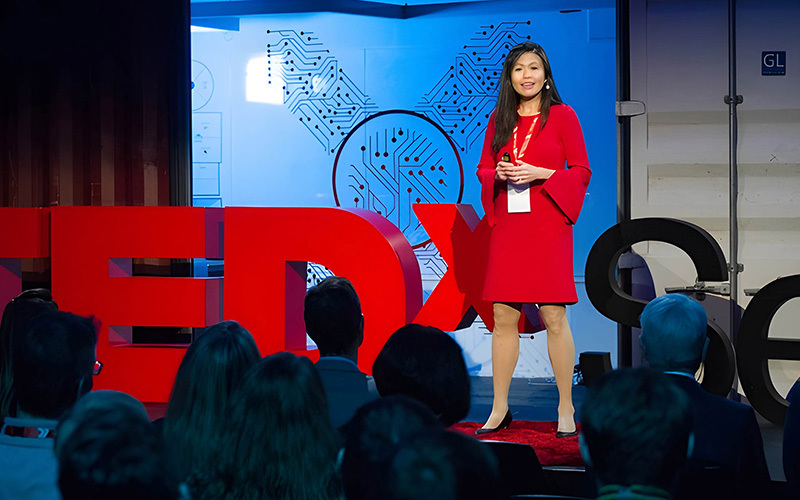
Aktuelles
Venturelab organisiert vom 13. bis 17. Mai eine Reise von Jungunternehmern aus dem Biotech-Sektor nach Boston. Die zehn Start-ups, die von einer Jury aus über 70 Bewerbungen ausgewählt wurden, nehmen laut einer Medienmitteilung des Start-up-Förderers als sogenannte Venture Leaders Biotech an der Roadshow in Boston teil, einem der wichtigsten Life-Science-Zentren der Welt. Sie werden sich und ihre Jungunternehmen bei einer Auftaktveranstaltung am 22. April beim Swiss Biotech Day 2024 in Basel vorstellen.
„Die Vorbereitung auf diese Roadshow, die bereits zum 18. Mal stattfindet, ist ein Tribut an die Qualität der Innovationen und Start-ups, die bereits Teil dieser Reise waren“, wird Venturelab-Mitgründer und CEO Jordi Montserrat zitiert. „Ich kann es kaum erwarten, bei dieser neuen Ausgabe dabei zu sein und dieses neue Team bei seiner internationalen Expansion zu unterstützen."
Diese zehn Biotech-Start-ups sind in diesem Jahr dabei: Adoram Therapeutics aus Genf, das niedermolekulare Therapien zur Behandlung von Krebs, Entzündungen und anderen Krankheiten entwickelt. Das Basler Biopharma-Start-up Allegria Therapeutics baut ein differenziertes Portfolio an therapeutischen Ansätzen rund um biologische Zielmoleküle auf. Eviive aus Zürich arbeitet an neuartigen Biomarkern. inSEIT aus Bern widmet sich der Verbesserung von Enzymen. Kylys Aesthetics aus Genf setzt auf einen biokompatiblen Dermalfüller.
OBaris mit Sitz in Zürich ermöglicht die schmerzfreie Verabreichung von injizierbaren Medikamenten über ein kleines, nadelfreies Pflaster im Mund. Shape Biopharmaceuticals, ebenfalls aus Zürich, verbindet medizinisch-chemisches Fachwissen mit computergestütztem Proteindesign. TissueLabs in Manno TI ist auf fortschrittliche Biofabrikation spezialisiert. Well Science aus Zürich will die Behandlung von Allergien der Atemwege revolutionieren. Und Ymmunobio in Basel konzentriert sich auf gastrointestinale Krebserkrankungen. ce/gba

Venturelab Biotech 2024 ermöglicht zehn Biotech Start-ups einen Aufenthalt in Boston. Bild: Harald Johnsen, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Aktuelles
Die Statements -zuerst publiziert im Magazin 'persönlich'- geben umfassende Einblicke in aktuelle und künftige Herausforderungen verschiedener Branchen. Die zentralen Themen reichen von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz über Nachhaltigkeit, demografischen Wandel, Cyber-Sicherheit, Fachkräftemangel bis hin zum Klimawandel. Experten aus unterschiedlichen Feldern wie Versicherungen, IT, Bau und Elektrotechnik teilen ihre Perspektiven und Ansätze, um diesen Trends zu begegnen. Sie betonen die Bedeutung von Innovationen, Anpassungsfähigkeit und nachhaltigen Lösungen für die zukünftige Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung. Hier zusammenfassend die wichtigsten Aussagen:
Hier geht es zum PDF des ausführlichen Beitrages im Magazin 'persönlich',dem führenden Schweizer Kommunikationsmagazin für Entscheider und Meinungsführer.

Aktuelles
Für Unternehmen sind Innovationen der entscheidende Faktor für den langfristigen Markterfolg. Gleichzeitig bedingen sie aber grosse Investitionen und stellen ein hohes Risiko dar. «Ein Innovationsprojekt kostet schnell mal zwei Millionen Franken, und es vergehen gut und gerne zwei Jahre, bis wir wissen, ob sich die neue Idee in ein marktreifes Produkt umsetzen lässt, das seine Kunden findet», sagt Ian Roberts, der Chief Technology Officer der Bühler Group. Der Schweizer Technologiekonzern ist ein weltweit führender Hersteller von Maschinen für die Lebensmittelindustrie und weiterer Industriezweige.
Wie sich Entwicklungs- und Innovationsprozesse beschleunigen und die Risiken minimieren lassen, um diese Fragen dreht sich die Forschung von Mirko Meboldt, Professor für Produktentwicklung und Konstruktion an der ETH Zürich. An der Hochschule betreibt er das Feasibility Lab, das Firmen dabei unterstützt, ihre Innovationsideen zu testen.
In diesem Reallabor entwickeln Studierende und Postdocs gemeinsam mit den Auftraggebern möglichst einfache Prototypen, die zentrale Funktionen von Industrieprozessen abbilden, die verändert werden sollen. Beim Bau ihrer «Critical Function Prototypes», wird alles weglassen, was für die Überprüfung einer bestimmten Hypothese bzw. Innovationsidee nicht notwendig ist. Als «Lean-De-Risking» bezeichnet das Feasibility Lab die verfolgte Strategie.
Das Feasibility Lab und die Bühler Gruppe sind im letzten Jahr eine Kooperation eingegangen, das BEXL – Bühler Exploration Lab, um das Lean De-Risking im internen Innovationsprozess des Industriekonzerns zu testen. Unter der Leitung von drei erfahrenen Projektleitern des ETH-Labors wirkt zurzeit ein Team von acht Studierenden im CUBIC, dem Innovationscampus von Bühler in Uzwil. Ende 2023 haben sie dem Bühler Management erste Resultate präsentiert.
Lassen sich Produkte, die aus dem Extruder kommen, beispielsweise Tierfutter oder Cerealien, statt mit heisser Luft auch mit Heissdampf trocknen? Diese Methode hat von der Physik her das Potenzial, energieeffizienter zu sein. Um zu entscheiden, ob sich dieses theoretische Konzept in einem Produkt nutzen lässt, entwickelten die ETH-Studierenden eine modulare Versuchsanlage, auf der verschiedene Teilsysteme schnell getestet werden können.
Den 160 Grad heissen Dampf erzeugen sie mit einem Tauchsieder, den sie an einen Ofen anschlossen. Entscheidend ist, dass das Transportband das Material so in den Ofen bringen kann, dass kein Dampf entweicht. Das ist zentral, weil das Entweichen von Dampf die Energiesparnisse zunichtemachen würde. Zwei Wochen haben die Studierenden gebraucht, bis sie nachweisen konnten, dass die Methode tatsächlich funktioniert. Und das auch noch günstig: Den Ofen haben sie für 70 Franken auf einer Occasionsplattform erstanden.
«Das ist ein typisches Beispiel dafür, wie unsere Studierenden verrückte Ideen in Prototypen überführen, die sich auf den kritischen Erkenntnisgewinn fokussieren», sagt Kai von Petersdorff-Campen, einer der drei Projektleiter aus dem Feasibility Lab. «Die Messungen der Versuche bilden die Grundlage, um den Prototyp in einzelnen Sprints weiter in Richtung Produkt zu entwickeln», erklärt er.
Mirko Meboldt zeigt sich erfreut, dass die Methoden aus dem Lab auch in der Praxis vor Ort funktionieren: «Für uns ist es unerlässlich, an realen Projekten arbeiten zu können, um zu zeigen, dass die neuen Methoden eine Wirkung erzielen.» Gleichzeitig sei für eine erfolgreiche Implementierung der Methoden entscheidend, dass sich die Forschenden in der Industrie umfassend mit ihnen beschäftigten. Das geschehe am effektivsten, wenn sie an realen Projekten mitarbeiteten.
So erhalten die Studierenden die Fragestellungen in Uzwil nicht von den Projektleitern oder vom Professor. Es sind die 24 Business Units von Bühler, die mit ihren Projekten und Innovationsideen auf sie zukommen. Bisher sind 60 Projekte zusammengekommen, einfachere und komplexere. Bei der Priorisierung sind die Studierenden sehr frei, ausschlaggebend ist die Neugier und die passende Expertise.
Beim Entwickeln ihrer Lösungen arbeiten die Studierenden eng mit den Ingenieur:innen von Bühler zusammen. Zunächst löchern sie diese so lange mit Fragen, bis alle Beteiligten das gleiche Verständnis der Fragestellung haben, die hinter der ursprünglichen Innovationsidee steckt. Je nach Komplexität durchläuft die Idee verschieden lange Formate, vom einstündigen Workshop bis zum Wochenprojekt.
Eine der ersten Business Unit, die auf die Studierenden zukam, war jene für Getreide und Hülsenfrüchte. Das Anliegen: Die Entwicklung eines Geräts, mit dem Müllereibetriebe bei der Lieferung von Hafer die Qualität feststellen können, um den entsprechenden Preis festzulegen.
Für die Studierenden stellte sich zunächst die Frage, was so ein Testgerät messen müsste. Neben dem Verhältnis von Korn und Spreu entscheidet beim Hafer die Schälbarkeit der Körner über die Qualität, denn sie bestimmt die Effizienz im Verarbeitungsprozess. Es ging also darum, die wesentlichen Funktionen, welche den Verarbeitungsprozesses auf den grossen Maschinen bestimmen, auf ein kleines Testgerät zu übertragen.
«Als kritische Funktion identifizierten wir die Beschleunigung des Kornes», erklärten von Hopffgarten und Verzaroli bei der Präsentation des ersten Prototyps, den sie aus Karton gefertigt und mit Luftdruck angetrieben hatten. Nach erfolgreichen Tests bauten sie einen zweiten Prototyp, um den Schälprozess abzubilden. Dafür verwendeten sie Material aus dem Heimwerkergeschäft. Schliesslich folgte ein dritter, aufwendigerer Prototyp, dessen Schälresultate sich mit jenen der Industriemaschinen vergleichen lassen.
«Das schrittweise Vorgehen zeigt exemplarisch, was wir mit Lean De-Risking meinen», sagt von Petershoff-Campen. Der Aufwand für einen Test soll in einem gesunden Verhältnis stehen zum aktuellen Wissensstand. «Wir nennen das Smart Zone», sagt der Forscher.
Für den ersten Prototyp wendeten die Studierenden gerade mal 18 Arbeitsstunden auf, und sie arbeiteten mit Pappe. Der zweite Prototyp war nach 40 Arbeitsstunden fertig, und erst dann nahmen sie den dritten in Angriff, in den sie rund 400 Arbeitsstunden investierten. Mit jeder Iteration wurden Unsicherheiten abgebaut, was wiederum eine etwas grössere Investition in den nächsten Prototypen rechtfertigte.
«Ich bin begeistert, wie sich die ETH-Studierenden hier bei Bühler eingelebt haben, und ich bin tief beeindruckt, wie rasch sie mit den Prototypen grundlegende Fragen beantworten können», lobt Ian Roberts die Arbeit. «Mit unseren etablierten Entwicklungsmethoden hätte ein Projekt wie der Haferschäler bestimmt zwei Jahre statt zwei Monate gedauert, und es hätte ein Vielfaches an finanziellen Mitteln verschlungen», erklärt er. Aufgrund der Testergebnisse mit dem Prototyp entwickle nun die Business Unit ein Produkt, das im Frühling ersten Kunden vorgestellt werden soll.
Der CTO von Bühler ist überzeugt, dass auch kleinere Firmen der Schweizer Maschinenindustrie von einer solchen Zusammenarbeit profitieren könnten. «Wir prüfen zurzeit die Idee, unseren CUBIC beispielsweise für Swissmem-Partnerfirmen zu öffnen, um ihnen eine Kooperation mit der ETH hier in Uzwil zu ermöglichen», sagt er.
Auch seitens ETH ist man offen für eine Ausweitung der Kooperation. «Wir sind äusserst zufrieden, dass sich unser Ansatz auch in der Praxis bewährte und wir damit Schweizer Industriebetriebe unterstützen können», sagt Meboldt. Gleichzeitig seien die Studierenden begeistert und hätten enorm profitiert von diesem Einblick in die Praxis.
Autor: Roland Baumann

Studierende arbeiten an «Critical Function Prototypes», bei denen alles weggelassen wird, was für die Überprüfung einer bestimmten Hypothese bzw. Innovationsidee nicht notwendig ist. (Bild: Alessandro Della Bella)

Die ETH-Studierenden Kyo Mangold, Daniel Gisler, Pierre-Louis Cramer, Jannis Reichenstein, Lea Kotthoff, Rajan Abramowski, Arne von Hopffgarten und Diego Verzaroli (v.l.n.r.) bauen bei der Bühler Group Prototypen, die zu schnelleren Investitionsentscheiden führen. Intern bekannt sind sie als BEXL-Team, abgeleitet von Bühler Exploration Lab. (Bild: Alessandro Della Bella)

Jannis Reichenstein und Lea Kotthoff freuen sich über den Applaus, den sie bei der Präsentation ihres «Heissdampf-Trockners» erhalten. (Bild: Alessandro Della Bella)

Bühler CTO Ian Roberts (links) und ETH-Professor Mirko Meboldt (rechts) überlegen, wie sie die Kooperation skalieren können. (Bild: Alessandro Della Bella)

Diego Verzaroli gibt Haferkörner in den Prototyp, dessen Schälresultate mit jenen von Industriemaschinen verglichen werden können. (Bild: Alessandro Della Bella)
Aktuelles
Originalität, Qualität und Relevanz der Forschung, verbunden mit Überzeugungskraft und dem Potenzial für zukünftige Innovationen, bilden die Kriterien des FAN Awards. Die Arbeiten von Melanie Ehrler, Simon Walo und Regina Weder erfüllen diese herausragend. Diese drei vielversprechenden Nachwuchswissenschaftler:innen wurden während des erstmalig durchgeführten Networking-Events «Sparkling Research» mit dem FAN Award ausgezeichnet. Dieser Preis wird jährlich durch den Fonds zur Förderung des akademischen Nachwuchses (FAN) von UZH Alumni vergeben. Die Fakultäten nominieren drei Nachwuchsforschende in den Fachbereichen Medizin und Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Eine durch den Graduate Campus organisierte Jury wählt die Preisträger:innen aus.
Eines von hundert Kindern wird mit einem Herzfehler geboren und viele von ihnen benötigen bereits als Neugeborene lebensrettende Eingriffe. Wie es diesen Kindern und ihren Familien langfristig geht, erforschte Melanie Ehrler, Postdoktorandin in der Abteilung Entwicklungspädiatrie des Universitäts-Kinderspitals Zürich, und publizierte dazu mehrere Fachartikel. Sie konnte zeigen, dass ein beträchtlicher Teil der Kinder mit Herzfehlern im Vergleich zu gesunden Gleichaltrigen ein höheres Risiko aufweist für Entwicklungsprobleme wie Aufmerksamkeitsdefizite oder Lernprobleme. Dies kann zu Schwierigkeiten in der Schule und zu Verhaltensproblemen im Alltag führen. Mittels Magnetresonanztomographie (MRT–Aufnahmen des Gehirns) hat Melanie Ehrler aufgezeigt, dass den Entwicklungsproblemen oftmals Veränderungen in bestimmten Hirnregionen zugrunde liegen. Eine besonders wichtige Erkenntnis ihrer Arbeit zeigt, dass viele Eltern langfristig emotional stark belastet sind, was sich zusätzlich negativ auf die kindliche Entwicklung auswirkt. Ehrlers Forschungsergebnisse legen dar, dass eine Betreuung der ganzen Familie wichtig ist und die langfristige Beurteilung und Förderung der Entwicklung dieser Kinder ein essenzieller Bestandteil der medizinischen Versorgung darstellt.
Soziologe Simon Walo hat in seiner Dissertation über die Zukunft der Arbeit, die aus drei Einzelstudien besteht, neue, wichtige und gesellschaftsrelevante Forschungsergebnisse erarbeitet. In seiner ersten Studie untersucht er, wie die Automatisierung verschiedene Berufe unterschiedlich beeinflusst. Dabei zeigt er, dass widersprüchliche Ergebnisse in der bestehenden Literatur auf Unterschiede in der Methodik zur Messung von Automatisierbarkeit zurückzuführen sind. Ebenfalls legt er dar, dass die Auswirkungen des technologischen Fortschritts auf dem Arbeitsmarkt nur in Kombination mit sozialen Faktoren betrachtet werden können. Die zweite Studie untersucht mit Hilfe von Umfragedaten aus den Vereinigten Staaten, weshalb Menschen ihre Jobs als sozial nutzlos empfinden. Seine Ergebnisse stützen dabei die «Bullshit-Jobs-Theorie» von David Graeber. Dies könnte darauf hinweisen, dass gewisse Arten von Arbeit tatsächlich keinen gesellschaftlichen Nutzen haben und somit in Zukunft auch nicht benötigt werden. Die dritte Studie zeigt schliesslich mit einer KI-gestützten Auswertung des gesamten englischen Google-Books-Datensatzes, dass sich die gesellschaftliche Bedeutung und Bewertung von Arbeit über die Zeit ändert. Ein Prozess, der auch in Zukunft weitergehen dürfte.
Im Bereich der öffentlichen Verwaltung stellt sich die Frage, unter welchen rechtlichen Bedingungen algorithmische Systeme verwendet werden können, sei es für Entscheidungsprozesse oder Routineaufgaben. Das Dissertationsprojekt von Regina Weder zielt darauf ab, klare Leitlinien für den Einsatz von Algorithmen zu entwickeln und Transparenzregeln zur Weiterentwicklung der geltenden Leitlinien vorzuschlagen. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Demokratie in Aarau untersucht sie, welche Anforderungen das Recht an die Transparenz behördlicher Algorithmen stellt und wie bestimmte Transparenzregeln dazu beitragen können, das Risiko algorithmischer Diskriminierung zu kontrollieren. Sie greift dabei auf Diskurse aus der Informatik und den Kritischen Daten- und Algorithmenstudien zurück, die sich mit den normativen Aspekten des Algorithmendesigns befassen. Denn: Die Funktionsweise und Risiken eines Algorithmus sind immer auch von seinem behördlichen Kontext und den beteiligten Personen abhängig. In ihrer Forschungsarbeit führt sie Grundlagen und Erkenntnisse aus der Informatik mit der rechtswissenschaftlichen Regulierungsdebatte zusammen.

Bild in Detailansicht öffnen Die diesjährigen Gewinner:innen des FAN Awards: Melanie Ehrler, Simon Walo und Regina Weder (Bild: Nicolas Zonvi)
Aktuelles
43 neue Gründungen ist eine ausserordentlich hohe Zahl – mit der die ETH Zürich im europäischen Vergleich besonders gut abschneidet. Ein Forschungsbereich, den die ETH intensiv ausbaut, spiegelt sich auch in den Firmengründungen wider: die Künstliche Intelligenz. Von den 43 gegründeten Spin-offs weisen zwölf einen klaren Bezug zur KI auf. Beispielsweise Quazel, eine App, die KI für das Sprachenlernen einsetzt. Mithilfe eines KI-Agenten können Lernende Gespräche zu beliebigen Themen führen, während die KI dynamisch auf alles reagiert, was gesagt wird. Auch das junge Team von BreezeLabs setzt eine KI-Software ein. Diese misst über das eingebaute Mikrofon in Standard-Kopfhörern die Atemfrequenz. Dadurch können während körperlicher Aktivität personalisierte und zielgerichtete Trainingsempfehlungen gegeben werden.
Neben KI ist die ETH traditionell sehr stark in der Biotechnologie und Pharmazie. Dieser Bereich macht den grössten Anteil der neugegründeten Spin-offs im Jahr 2023 aus. Ein Beispiel ist das Biotech-Spin-off ATLyphe. Ihr Ziel ist es, die Chemotherapie durch antikörperbasierte Therapien zu ersetzen, um die hämatopoetische Stammzellentransplantation potenziell sicherer und effektiver zu gestalten.
Der Anteil von Gründerinnen bei den ETH-Spin-offs ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. In konkreten Zahlen bedeutet das – 2023 wurden elf Firmen an der ETH von Frauen mitgegründet. Dies freut Vanessa Wood, Vizepräsidentin für Wissenstransfer und Wirtschaftsbeziehung an der ETH Zürich: «Dass wir immer mehr Frauen dazu begeistern können, Unternehmerinnen zu werden, erfüllt mich nicht nur persönlich mit Freude, sondern ist auch für die Schweizer Wirtschaft und die Gesellschaft wichtig.» Ein konkretes Beispiel dafür ist der Spin-off apheros. CEO Julia Carpenter und ihr Team haben neuartige Metallschwämme erfunden, die Kühleigenschaften besitzen. Da die Kühlung von elektronischen Geräten oft energieintensiv ist, bieten die Schwämme von apheros mit ihrer grossen Oberfläche und hohen Leitfähigkeit eine effiziente Kühllösung.
Ein besonderes Jahr war es auch in Bezug auf Grants, welche ETH-Spin-offs erhielten. 2023 flossen 47 Millionen Schweizer Franken in ETH-Spin-offs, ohne dass dabei die bestehenden Anteile der aktuellen Eigentümer verwässert wurden. Zudem gab es einige beträchtliche Investitionsrunden. Zum Beispiel schloss das Spin-off GetYourGuide, eine Online-Plattform für Reiseaktivitäten, eine neue Finanzierungsrunde von über 70 Millionen Franken ab. Das Spin-off ANYbotics, das autonome Roboter für Inspektionen anbietet, erhielt 50 Millionen Franken. Ebenso profitierten die beiden Drohnen-Technologie-Firmen Verity und Wingtra von Fördergeldern. Verity erhielt 40 Millionen für ihre selbstfliegenden Inventurdrohnen, während Wingtra 20 Millionen Franken für ihre Drohnen erhielt, die für kartografische und geodätische Anwendungen eingesetzt werden. Mit Memo Therapeutics hat ein Biotechnologie-Unternehmen eine Finanzierungsrunde von 25 Millionen Schweizer Franken abschliessen können, für die Forschung an therapeutischen Antikörpern zur Behandlung von Infektionskrankheiten.
Seit 1973 sind 583 Spin-offs an der ETH Zürich entstanden. Eine Liste sämtlicher Spin-offs finden Sie hier; Informationen zu Akquisitionen und Börsengängen von ETH-Spin-offs finden Sie hier. Anerkannte ETH-Spin-offs werden vom ETH-Bereich Wissenstransfer und Wirtschaftsbeziehungen bei ihrer Gründung und in den oft entscheidenden darauffolgenden Jahren durch Beratung, Lizenzierung von ETH-Technologien und Kontaktvermittlung unterstützt.
Eine umfassende Analyse der Universität St.Gallen aus dem Jahr 2020 hat ergeben, dass ETH-Spin-offs leistungsfähiger sind, mehr Arbeitsplätze schaffen und auch häufiger übernommen werden als durchschnittliche Schweizer Start-ups.

Treeless Pack ist eines der 2023 gegründeten ETH Spin-offs. Hier mit den beiden Co-Foundern Patrycja Kucharczyk und Adam Aleksander Korczak. (Bild: ETH Zürich / Nicole Davidson)
Aktuelles
Der neue FoodHUB Wädenswil ist am 1. Februar offiziell eröffnet worden. Er soll ein Ort für Vernetzung, Austausch und Zusammenarbeit sein und Innovationen vorantreiben. Zu diesem Zweck haben das Amt für Wirtschaft des Kantons Zürich mit seiner Standortförderung, die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und die Stadt Wädenswil gemeinsam einen Verein gegründet.
Einer Medienmitteilung des Kantons zufolge arbeitet der FoodHUB Wädenswil eng mit der Stiftung Foodward zusammen. Sie hat im vergangenen Jahr das Pioneer-Förderprogramm, ein neues Angebot für Food-Start-ups, ins Leben gerufen. In den kommenden Monaten sollen weitere Partnerinnen, Partner und Mitglieder gewonnen werden, um den FoodHUB Wädenswil breiter zu verankern.
Hintergrund ist der Umstand, dass die Food-Branche im Kanton Zürich in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen ist. Laut einer kantonalen Studie zum Agro-Food-Ökosystem im Kanton Zürich konnten dort 2022 knapp 11'000 Unternehmen dem Lebensmittelsektor zugerechnet werden.
„Mit dem FoodHUB Wädenswil schaffen wir einen Raum, um Hochschulen und Unternehmen noch stärker zu vernetzen sowie Innovationen und technologischen Fortschritt im Ökosystem Food voranzutreiben und dadurch den Wirtschaftsstandort zu stärken“, wird Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh zitiert. „Durch die gebündelten Kompetenzen soll der FoodHUB Wädenswil über die Kantonsgrenzen hinweg zu einem Leuchtturm für Food-Innovationen werden.“ ce/mm


Regierungsrätin Silvia Steiner, Vorsteherin der Bildungsdirektion, Regierungsrätin Carmen Walker Späh, Vorsteherin der Volkswirtschaftsdirektion, ZHAW-Rektor Jean-Marc Piveteau, Departementsvorsteher Urs Hilber, Claudia Bühlmann, Stadträtin Wädenswil, Fabian Streiff, Chef des Amtes für Wirtschaft. Bild: ZHAW
Aktuelles
Die Unternehmensbefragung 2023 der Standortförderung House of Winterthur hat allem voran ergeben, dass rund 87 Prozent der Befragten mit dem Wirtschaftsstandort Winterthur eher zufrieden, zufrieden oder sehr zufrieden sind. Das sind 0,3 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. 204 Personen nahmen zwischen dem 16. November und dem 16. Dezember an der Online-Befragung teil, 76 Prozent davon waren Mitglieder der Geschäftsleitung.
Im Unterschied zu 2022 ist der Fachkräftemangel mit 14,1 Prozent der Nennungen vom ersten auf den zweiten Platz der grössten Herausforderungen im kommenden Kalenderjahr gerutscht. Platz 1 nimmt neu der Preisdruck ein (14,9 Prozent). Dahinter zählen die Auftragslage, die Verkehrssituation und politische Bestimmungen zu den meistgenannten Problemen.
Je 37,6 Prozent der Befragten gaben bei der Umsatzentwicklung 2023 gegenüber dem Vorjahr entweder keine Veränderung oder eine Zunahme an. 30,2 Prozent erwarten für das laufende Jahr einen eher positiven und 42 Prozent einen positiven Geschäftsverlauf. Bei der Zahl der Mitarbeitenden wird es etwa wie im Vorjahr für 61,4 Prozent keine Veränderungen geben. 31,3 Prozent wollen neues Personal einstellen.
Deutlich verändert hat sich die Investitionsbereitschaft: 51,7 Prozent der Unternehmen planen im neuen Kalenderjahr Investitionen. Im Jahr 2021 waren dies noch lediglich 22,9 Prozent.
Das House of Winterthur hatte für die aktuelle Befragung den Themenschwerpunkt auf die Positionierung der Wirtschaftsregion gelegt. Die Ergebnisse zeigen laut dessen Leiter Wirtschaft, Sven Corus, dass 60 Prozent diese als unklar empfinden: „Gemeinsam mit der Stadt Winterthur arbeiten wir deswegen aktuell an einer Positionierungsstudie“. ce/mm

Der weltweit tätige Spinnereimaschinenhersteller Rieter hat seinen Sitz in Winterthur. Bild: Rieter
Aktuelles
Künstliche Intelligenz (KI) ist unaufhaltsam auf dem Vormarsch und hat ein enormes Potenzial. Allerdings gibt es noch viele offene Fragen – auch was die Regulierung betrifft. Der Kanton Zürich bringt schon seit langem die praktische Anwendung von KI voran. Im Frühling 2022 wurde die «Innovation-Sandbox» eingeführt. Sie dient als Lernumgebung – quasi wie ein Labor – in welcher Firmen, Organisationen und Verwaltung KI-Vorhaben umsetzen und Expertise im Bereich KI-Einsatz entwickeln. Daraus sind schon mehrere Leitfäden zu rechtlichen Aspekten und Empfehlungen zur technischen Implementierung von KI-Anwendungen entstanden.
Auch in anderen Ländern laufen ähnliche Sandbox-Projekte, zum Teil mit unterschiedlichen Ansätzen. Deshalb hat die Standortförderung im Kanton Zürich gemeinsam mit dem europäischen KI-Netzwerk CLAIRE erstmals den «AI Sandbox Summit» organisiert und Fachleute aus sechs europäischen Ländern eingeladen: Deutschland, Belgien, Norwegen, Grossbritannien, Frankreich und Spanien. Das Ziel war es, sich zu vernetzen, auszutauschen und von den Erfahrungen anderer zu lernen.
Auf welche Themen fokussieren die Projekte? Was sind die Teilnahmebedingungen für die Organisationen? In welcher Form werden die Resultate präsentiert? Zunächst teilten die Sandbox-Expertinnen und -Experten Erfolgsfaktoren und länderübergreifende Erkenntnisse. Im zweiten Teil der Veranstaltung entwickelten die Teilnehmenden Ansätze, wie man den Mehrwert für Verwaltung, Forschung und Wirtschaft erhöhen kann.
Für Raphael von Thiessen von der Standortförderung Kanton Zürich und Projektleiter der «Innovation-Sandbox» war die Veranstaltung im FFHS Campus Zürich ein voller Erfolg: «Die Teilnehmenden haben enorm vom Austausch und den Erfahrungen in anderen Ländern profitiert und Optimierungspotenzial für die eigenen Projekte eruiert.» Auch eine länderübergreifende Zusammenarbeit wurde andiskutiert, zum Beispiel eine zentrale Projektdatenbank mit Erkenntnissen aus allen europäischen Sandbox-Fallbeispielen. Die Erkenntnisse aus dem Workshop werden demnächst auf der Webseite der kantonalen Standortförderung sowie auf der Webseite des europäischen KI-Netzwerks CLAIRE veröffentlicht. Im Kanton Zürich sollen die gesammelten Eindrücke in die zweite Phase der «Innovation-Sandbox» einfliessen.
Standortförderung Kanton Zürich
Europäisches KI-Netzwerk CLAIRE
Autor: Amt für Wirtschaft - Kanton Zürich


15 Teilnehmende tauschten sich am AI Sandbox Summit aus. Quelle: CLAIRE / Hannah Lea Dykast

Welche Erkenntnisse kann ich für mein eigenes Projekt mitnehmen? Darüber diskutierten die Teilnehmenden in verschiedenen Workshops. Quelle: CLAIRE / Hannah Lea Dykast
Aktuelles
Ab dem 1. März 2024 wird der Kanton Zürich einen Digital Innovation Hub besitzen. Das kantonale Labor wird von Maren Kottler geleitet, die zuvor als Managerin Foresight & Open Innovation bei der Schweizerischen Post gearbeitet hat. Dies bestätigt die Finanzdirektion, bei der das Amt für Informatik (AFI) angesiedelt ist, auf Anfrage. Unter ihrer Leitung sollen vier Fachleute eine Community-Plattform etablieren und bereits gestartete Vorhaben wie die KI-Sandbox sowie Akteure aus Bildung, Wirtschaft und Verwaltung verzahnen.
Derzeit sucht der Kanton über 14 Bereiche eine Menge IT-Dienstleistungen für das Applikationsmanagement, darunter für Virtual und Augmented Reality, Künstliche Intelligenz, Internet of Things und Blockchain. Eine zentrale Übersicht über die Innovationsthemen gibt es derzeit noch nicht, wie ein Pressesprecher der Finanzdirektion erklärt. Das soll der Digital Innovation Hub ändern. Dessen Community-Plattform soll einen Überblick über die innovativen Projekte der Verwaltung erlauben und den Technologietransfer unter den Projekten ermöglichen.
Für Blockchain-Anwendungen erhofft sich der Kanton Anbieter, die bei Bedarf bis 2027 jährlich 300 Personentage stemmen können. Es geht um Projekte für Applikationen, aber auch um Machbarkeitsstudien, Beratung und Schulung von Mitarbeitenden des Kantons. Schliesslich wird auch Support und Unterstützung im Betrieb verlangt.
Es handelt sich aber eher um eine präventive Beschaffung. Konkrete Projekte, in denen Blockchain für die Abwicklung von Geschäftsvorhaben eingesetzt oder dies mindestens geprüft werde, seien derzeit nicht bekannt, heisst es von der Pressestelle. Es sei aber nicht auszuschliessen, dass die Technologie in Produkten von Lieferanten zum Einsatz komme.
Anders sieht es mit Künstlicher Intelligenz aus. Die Technologie wird in Voice- und Chatbots bereits eingesetzt, wo sie die Intention von Usern erkennen und entsprechende Antworten liefern sollen. Weitere KI-Projektbeispiele sind der "Digital Learning Hub" des Mittel- und Berufsschulamts und die "Innovations-Sandbox" der Volkswirtschaftsdirektion. Der KI-Einsatz ist in einem kantonalen Leitfaden umschrieben, aktuelle Projekte sind auf der Kantonswebsite aufgelistet.
Auch IoT-Geräte werden im Kanton bereits eingesetzt. So nutzt das Amt für Informatik unter den Tischen verbaute Sensoren. Diese generieren Daten bezüglich der Belegung der Arbeitsplätze. Weitere Sensoren erzeugen Informationen zum Raumklima und zu der Akustik. An Augmented und Virtual Reality wird an der Bildungs- und Forschungsanstalt Strickhof geforscht. An der Olma wurde am Strickhof-Stand laut Medienstelle mittels VR-Brille aufgezeigt, wie die Innereien einer Kuh aussehen und mit welchen Fütterungsstrategien die Verdauung beeinflusst wird.
Autor: Thomas Schwendener

Foto: Rico Reutimann / Unsplash
Aktuelles
Der Balgrist Campus – eine Forschungseinrichtung von nationaler Bedeutung des Bundes – ist eine gemeinnützige, steuerbefreite Institution, die ganz im Zeichen des muskuloskelettalen Patienten von heute steht und sich speziell dem muskuloskelettalen Patienten von morgen widmet. In der Rolle eines Inkubators werden Patienten, Ärzte, Forscher und die Industrie unter einem Dach mit dem gemeinsamen Ziel zusammengeführt, die Gesundheit von Patienten mit Beschwerden am Bewegungsapparats zu verbessern.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an fabienne.gentile@balgristcampus.ch.




Aktuelles
43 neue Gründungen ist eine ausserordentlich hohe Zahl – mit der die ETH Zürich im europäischen Vergleich besonders gut abschneidet. Ein Forschungsbereich, den die ETH intensiv ausbaut, spiegelt sich auch in den Firmengründungen wider: die Künstliche Intelligenz. Von den 43 gegründeten Spin-offs weisen zwölf einen klaren Bezug zur KI auf. Beispielsweise Quazel, eine App, die KI für das Sprachenlernen einsetzt. Mithilfe eines KI-Agenten können Lernende Gespräche zu beliebigen Themen führen, während die KI dynamisch auf alles reagiert, was gesagt wird. Auch das junge Team von BreezeLabs setzt eine KI-Software ein. Diese misst über das eingebaute Mikrofon in Standard-Kopfhörern die Atemfrequenz. Dadurch können während körperlicher Aktivität personalisierte und zielgerichtete Trainingsempfehlungen gegeben werden.
Neben KI ist die ETH traditionell sehr stark in der Biotechnologie und Pharmazie. Dieser Bereich macht den grössten Anteil der neugegründeten Spin-offs im Jahr 2023 aus. Ein Beispiel ist das Biotech-Spin-off ATLyphe. Ihr Ziel ist es, die Chemotherapie durch antikörperbasierte Therapien zu ersetzen, um die hämatopoetische Stammzellentransplantation potenziell sicherer und effektiver zu gestalten.
Der Anteil von Gründerinnen bei den ETH-Spin-offs ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. In konkreten Zahlen bedeutet das – 2023 wurden elf Firmen an der ETH von Frauen mitgegründet. Dies freut Vanessa Wood, Vizepräsidentin für Wissenstransfer und Wirtschaftsbeziehung an der ETH Zürich: «Dass wir immer mehr Frauen dazu begeistern können, Unternehmerinnen zu werden, erfüllt mich nicht nur persönlich mit Freude, sondern ist auch für die Schweizer Wirtschaft und die Gesellschaft wichtig.» Ein konkretes Beispiel dafür ist der Spin-off apheros. CEO Julia Carpenter und ihr Team haben neuartige Metallschwämme erfunden, die Kühleigenschaften besitzen. Da die Kühlung von elektronischen Geräten oft energieintensiv ist, bieten die Schwämme von apheros mit ihrer grossen Oberfläche und hohen Leitfähigkeit eine effiziente Kühllösung.
Ein besonderes Jahr war es auch in Bezug auf Grants, welche ETH-Spin-offs erhielten. 2023 flossen 47 Millionen Schweizer Franken in ETH-Spin-offs, ohne dass dabei die bestehenden Anteile der aktuellen Eigentümer verwässert wurden. Zudem gab es einige beträchtliche Investitionsrunden. Zum Beispiel schloss das Spin-off GetYourGuide, eine Online-Plattform für Reiseaktivitäten, eine neue Finanzierungsrunde von über 70 Millionen Franken ab. Das Spin-off ANYbotics, das autonome Roboter für Inspektionen anbietet, erhielt 50 Millionen Franken. Ebenso profitierten die beiden Drohnen-Technologie-Firmen Verity und Wingtra von Fördergeldern. Verity erhielt 40 Millionen für ihre selbstfliegenden Inventurdrohnen, während Wingtra 20 Millionen Franken für ihre Drohnen erhielt, die für kartografische und geodätische Anwendungen eingesetzt werden. Mit Memo Therapeutics hat ein Biotechnologie-Unternehmen eine Finanzierungsrunde von 25 Millionen Schweizer Franken abschliessen können, für die Forschung an therapeutischen Antikörpern zur Behandlung von Infektionskrankheiten.
Seit 1973 sind 583 Spin-offs an der ETH Zürich entstanden. Eine Liste sämtlicher Spin-offs finden Sie hier; Informationen zu Akquisitionen und Börsengängen von ETH-Spin-offs finden Sie hier. Anerkannte ETH-Spin-offs werden vom ETH-Bereich Wissenstransfer und Wirtschaftsbeziehungen bei ihrer Gründung und in den oft entscheidenden darauffolgenden Jahren durch Beratung, Lizenzierung von ETH-Technologien und Kontaktvermittlung unterstützt.
Eine umfassende Analyse der Universität St.Gallen aus dem Jahr 2020 hat ergeben, dass ETH-Spin-offs leistungsfähiger sind, mehr Arbeitsplätze schaffen und auch häufiger übernommen werden als durchschnittliche Schweizer Start-ups.

Treeless Pack ist eines der 2023 gegründeten ETH Spin-offs. Hier mit den beiden Co-Foundern Patrycja Kucharczyk und Adam Aleksander Korczak. (Bild: ETH Zürich / Nicole Davidson)

2023 wurden an der ETH 43 Spin-offs gegründet – 23 mehr als im Vorjahr. (Grafik: ETH Zürich)








Aktuelles
Das Universitätsspital Zürich (USZ), das Stadtspital Zürich (STZ) und die Universität Zürich (UZH) verstärken ihre enge Zusammenarbeit in der Geriatrie weiter und richten zum 1. Januar 2024 ein gemeinsames Universitäres Zentrum für Altersmedizin ein. Es wird seinen Standort am Stadtspital Zürich Waid haben.
Dieses neue Zentrum bezweckt laut einer Medienmitteilung der drei Einrichtungen die Zusammenführung von universitärer Forschung und Lehre mit der klinischen Versorgung im Bereich der Altersmedizin und damit die Weiterentwicklung dieses Schwerpunkts am Stadtspital Zürich Waid. Dadurch sei für geriatrische Patientinnen und Patienten ein „nachhaltig stabiler und zukunftstauglicher Standort gesichert“. Dort könne das Leistungsangebot weiter verbessert und effizienter gestaltet werden.
Die akademische Leitung wird im Rahmen der gemeinsamen Strategie für Altersmedizin der drei Institutionen Prof. Dr. Dr. med. Heike Bischoff-Ferrari übernehmen. Als Inhaberin des Lehrstuhls für Geriatrie und Altersforschung der UZH wird sie zudem eine kantonale Zusammenarbeit mit ProSenectute und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Förderung der gesunden Langlebigkeit im WHO-Programm Integrated care for older people (ICOPE) koordinieren. Ausserdem wird Bischoff-Ferrari ab 2024 eine internationale Aufgabe als Direktorin des französischen Healthy Longevity und Geroscience Forschungsprogramms IHU HealthAge übernehmen und eine Forschungsbrücke zwischen der UZH, der Universität Toulouse und dem Universitätsspital Toulouse voranbringen.
Dr. med. Berta Truttmann, Geriaterin und stellvertretende Chefärztin des Stadtspital Zürich Waid, übernimmt ab 1. Januar 2024 die Leitung der Klinik für Altersmedizin innerhalb des Universitären Zentrums für Altersmedizin. Künftig wird sie die Klinik als Chefärztin leiten. ce/mm

Das Stadtspital Waid wird zum Standort des geplanten Universitären Alterszentrums. Bild: Stadtspital Waid Zürich
Aktuelles
Im Gesundheitssystem fallen jeden Tag viele Daten an: Blutwerte oder Ergebnisse von Gewebeproben, Ultraschall- oder MRT-Aufnahmen. Sie dienen der Diagnose und werden anschliessend archiviert. Doch was wäre, wenn Computersysteme eigenständig, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz, aus den gesammelten Daten der Patient:innen lernen und sogar neue Diagnosen und Behandlungen entwickeln würden? Die Auswertung grosser Datenmengen in der Medizin ist eines der dominierenden Themen in der Gesundheitsforschung. Wo stehen wir heute – und welche Perspektiven gibt es? Das waren die Fragen, die am Jahresanlass von The LOOP Zurich, im Zentrum standen. THE LOOP Zurich ist ein translationales Forschungszentrum mit Ausrichtung auf die Präzisionsmedizin. Die Veranstaltung fand letzte Woche an der UZH statt.
Seit 2020 forschen die Wissenschaftler:innen von The LOOP Zurich zu Präzisions- und datengetriebener Medizin. Es ist Spitzenforschung, die hier unter Beteiligung von UZH, ETH und den vier universitären Spitälern geleistet wird, – auch dank der Unterstützung von Stiftungen. «Forschung kostet, – gibt aber der Gesellschaft viel zurück», betonte Beatrice Beck Schimmer, Direktorin Universitäre Medizin Zürich, in ihrer Eröffnungsrede.
Ein wichtiges Projekt von The LOOP Zurich ist der Aufbau der Biomedizininformatik-Plattform (BMIP), die Daten nach dem FAIR-Prinzip für Forschungsprojekte zu Verfügung stellt. «FAIR» steht für Findable (auffindbar), Accessible (zugänglich), Interoperable (interoperabel), Reusable (wiederverwendbar). Bis 2025 will The LOOP Zurich die BMIP für den Austausch von Forschungs- und Gesundheitsdaten aufbauen. Den Auftrag dazu hat die Universitäre Medizin Zürich erteilt, die Regierung des Kantons Zürich hat die notwendigen Mittel gesprochen.
Wissenschaftler:innen, die für ihre Studien auf gesammelte Gesundheitsdaten zugreifen möchten, werden bei ihren Anträgen unterstützt, wie etwa beim Datenmanagementkonzept oder datenschutzrechtlichen und ethischen Vorgaben. Innerhalb von wenigen Wochen könnte so der Weg vom Forschungsantrag bis zur Analyse der Daten durchlaufen werden, sagte Gunnar Rätsch, ETH-Professor für Biomedizininformatik.
Christian Wolfrum, ETH-Vizepräsident für Forschung, betonte den Mehrwert, der für die Patient:innen aus der Biomedizininformatik-Plattform erwachsen wird. In Zukunft müsse man auch andere Spitäler und weitere Daten aus dem Bereich Public Health einbinden, wie etwa Gesundheits-Trackingdaten, so Wolfrum.
Markus Rudin, emeritierter Professor für Molecular Imaging und funktionelle Pharmakologie, betonte die klinische Translation, die für die The LOOP Zurich-Projekte bezeichnend sind. «Der Loop besteht darauf, dass Forschungsergebnisse zurück zu den Patient:innen gehen», sagte er und unterstrich das Gesagte anhand von zwei Projekten, die er in kurzen Video-Sequenzen vorstellte. «INTeRCePT» – erforscht Blutkrebs und Lymphdrüsenkrebs bei Kindern und Erwachsenen. «StimuLOOP» wiederum hat sich zum Ziel gesetzt, bei Parkinson- oder Schlaganfall-Patient:innen einhergehende Gehstörungen zu therapieren und so die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Beide Projekte ermöglichen durch ihren präzsisionsmedizinischen Ansatz die gezielte, erfolgreiche und schonende Behandlung von Patientinnen und Patienten.
Computersysteme können bereits heute eigenständig Gesundheitsdaten analysieren, daraus lernen und sogar Therapieempfehlungen herleiten. Welche Chancen das für die Patient:innen bedeutet und wie künstliche Intelligenz in der Praxis eingesetzt wird, berichtete Fabian Theis, Professor für Mathematische Modellierung biologischer Systeme an der TU München und Direktor des Instituts für Computational Biology am Helmholtz Zentrum München, der als Gastreferent zum Jahresanlass geladen war.
Künstliche Intelligenz beschreibt die Lernfähigkeit von Computerprogrammen. Für dieses Lernen gibt es zwei Wege, sagte Theis. Der erste Weg beschreibt das überwachte Lernen: Forschende zeigen dem Rechner eine grosse Zahl ähnlicher Dinge und vermitteln ihm dabei je nach Fragestellung, was richtig oder falsch ist, gesund oder krank. Die Idee dahinter: Wenn der Computer genügend Input bekommt, kann sein Algorithmus irgendwann selbst die Unterscheidung treffen. Auf diese Weise kann er den Mediziner:innen eine Menge Arbeit abnehmen. Doch es gibt noch einen zweiten Weg, um künstliche Intelligenz anzuwenden: Hier bekommt der Rechner möglichst wenig Hilfestellung, er soll ohne Überwachung lernfähig sein. Der Mathematiker Fabian Theis wendet diese Methode beispielsweise bei der sogenannten Einzelzellanalyse an: Der Computer erhält Daten über einzelne Zellen und ihren Stoffwechsel – und muss darin Muster finden. So lassen sich neue Zusammenhänge aufspüren.
Jens Selige, Geschäftsführer von The LOOP Zurich, stellte zwei Siegerprojekte vor, die jeweils am Jahresanlass gekürt werden. Die jungen Forschenden hatten sich bei der Ausschreibung beworben und sich gegen andere Projekte durchgesetzt. Damit verbunden ist eine grosszügige finanzielle Unterstützung für ihre Plattform-Projekte.
Sebastiano Caprara, stellte das erste Sieger-Projekt «Biomedical Informatics Imaging Platform» (BMI2) vor. BMI2 besteht aus einem Konsortium von verschiedenen Spitälern. Caprara arbeitet an der Universitätsklinik Balgrist und leitet derzeit die Digital Medicine Unit dort. Das Projekt BMI2 sammelt Bilddaten, zum Beispiel aus dem MRI und analysiert sie mit der sogenannten Segmentierung, einem Teilgebiet der digitalen Bildverarbeitung und des Computer-Sehens. «Die Analyse der Ergebnisse führt zu genaueren Diagnosen, zum Beispiel bei Schäden an einzelnen Wirbeln», so Caprara.
Das zweite Siegerprojekt wurde von Marco Bühler vorgestellt. Er arbeitet als Pathologe am Universitätsspital Zürich. Unter dem Namen «POLAR» wollen die Forschenden des Konsortiums, Daten von Patienten mit einem Lymphom zusammentragen. Dazu gehören Anamnesedaten, Daten aus der Bildgebung, Proteinanalytik und Pathologie wie auch genetische Daten. All diese Daten, die im Moment noch in unterschiedlichen Datenbanken erfasst werden, sollen in eine einzige Datenbank einfliessen. «Wir wollen den grössten Datensatz weltweit über Lymphome zusammentragen, mit dem Ziel, das Wissen in die Klinik zu den Patient:innen zurückzubringen und zur Heilung beizutragen», sagte Bühler.
Abgerundet wurde das Programm mit einer Expert:innenrunde, die die Bedeutung von Daten für die Zukunft der medizinischen Forschung diskutierten, und zwar aus verschiedenen Perspektiven. Die UZH-Professorin für Neurointensivmedizin und leitende Ärztin der Neurointensivstation des USZ, Emanuela Keller, beschrieb, wie Künstliche Intelligenz (KI) in der Intensivmedizin Entscheidungshilfen zur Behandlung von Patient:innen liefern könne, aber auch wie potenzielle Konflikte entstehen können, wenn die Empfehlungen der KI nicht mit dem Erfahrungswissen der Ärzt:innen übereinstimme. Gunnar Rätsch, Fabian Theis und Michael Krauthammer, Professor für Medizininformatik an der UZH, erläuterten, wie mittels moderner Prozessierungsmethoden Daten für Forschungszwecke genutzt werden könnten und welche datenschutzrechtlichen Aspekte dabei zu beachten sind. Die UZH-Juristin und Medizinerin Kerstin Vokinger, sprach darüber, mit welchen datenschutzrechtlichen Herausforderungen wir in Zukunft konfrontiert sein werden, besonders in der Schweiz, mit ihrem föderalistischen Rechtssystem, – denn nach wie vor gibt es in der Schweiz mehrere kantonale Datenschutzgesetze.
The LOOP Zurich ist ein translationales Forschungszentrum mit Ausrichtung auf die Präzisionsmedizin in Zürich. Es vereint die biomedizinische Grundlagenforschung und Bioinformatik der beiden Hochschulen, ETH Zürich und Universität Zürich, mit der klinischen Forschung von vier universitären Spitälern. Ziel ist es, mit Hilfe translationaler Forschung rasch neue Behandlungsmethoden zum Nutzen der Patienten zu entwickeln.

Die Auswertung grosser Datenmengen in der Medizin ist eines der dominierenden Themen in der Gesundheitsforschung. Seit 2020 forschen die Wissenschaftler:innen von The LOOP Zurich zu Präzisions- und datengetriebener Medizin.
Aktuelles
Mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie hat die ZHAW 2019 die Stossrichtung festgelegt. Das strategische Programm ZHAW sustainable treibt seitdem den Transformationsprozess voran. Mit dem ersten hochschulweiten Nachhaltigkeitsbericht erfolgt nun eine Bestandesaufnahme dessen, was die ZHAW bereits erreicht hat, welche Entwicklungen zu erkennen sind und wie die nächsten Meilensteine erreicht werden sollen. Im Zentrum steht, dass die ZHAW ihre Nachhaltigkeitsstrategie nur gemeinsam mit den Mitarbeitenden und Studierenden umsetzen kann. Einige von ihnen stehen im Bericht stellvertretend für die vielen ZHAW-Angehörigen, die sich in Forschung, Lehre, Hochschulbetrieb und auch persönlich für eine nachhaltige Entwicklung engagieren – in ökologischer, sozialer oder wirtschaftlicher Hinsicht.
Um die ökologischen Auswirkungen ihres Hochschulbetriebs zu reduzieren, setzt die ZHAW auf realistische Ziele und evidenzbasierte Massnahmen. Nach dem Motto «Man kann nur managen, was man messen kann» erhebt die ZHAW Daten in den Bereichen Geschäfts- und Pendelmobilität, Ressourcenverbrauch (Verpflegung, Papier, ICT, Wasser, Abfall) sowie Energieverbrauch der Gebäude. Bei Letzteren sorgt die Wärmeerzeugung für die meisten Treibhausgasemissionen, obwohl der Anteil an erneuerbaren Energien kontinuierlich wächst. Im Bereich Ressourcen sind die Verpflegung und die ICT-Geräte die grössten Posten. In der Geschäftsmobilität sind Flugreisen und in der Pendelmobilität Autofahrten die grössten Emissionsverursacher, die es zu reduzieren gilt.
Die ZHAW macht mit ihrem Bericht die Nachhaltigkeitsbestrebungen in ihren vier Leistungsbereichen und für die Gesellschaft transparent. Damit will sie ihrer Verantwortung gegenüber internen und externen Anspruchsgruppen gerecht werden. Künftig wird der Bericht alle zwei Jahre erscheinen. Die Veröffentlichung des ersten hochschulweiten Berichts gibt nun den Anstoss für einen «Multi-Stakeholder-Dialog» zur stetigen Verbesserung der nachhaltigen Entwicklung an der ZHAW. Eine Veranstaltungsreihe im Frühlingssemester 2024 wird diesen Prozess unterstützen.

Aktuelles
Im Verlauf des Netzwerktreffens wurde deutlich, dass in vielen Gemeinden in den drei zentralen Bereichen Mobilität, Wärme und Renovierung immer noch Strategien und entsprechende Massnahmen fehlen. Dabei zeigten unter anderem Expertinnen und Experten der Empa auf, wie genaue Betriebsdaten zur Schweizer Fahrzeugflotte (PKW, LKW) den Umbau der Flotte, den Zubau von Ladestationen oder «Shared Mobility»-Konzepte fördern und wie Gebäudesimulationen energetische Sanierungsstrategien unterstützen können. Der Kanton Luzern stellte dar, wie ein öffentlich zugängliches Online-Tool mit GIS-Daten im Bereich Wärme/Kälte den Ausstieg aus Gas und Öl voranbringen kann.
In der Diskussion unterstrichen die Teilnehmenden, dass es in allen Bereichen an guten Daten mangle. So sei zum Beispiel das hiesige Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) oft nicht aktuell. Oft verfügten die Gemeinden über weit bessere Daten, diese seien aber meist nicht digitalisiert und daher schwer zu nutzen. Es fehle den Kommunen an Geld und Personalressourcen, um diese zentralen Daten elektronisch aufzuarbeiten. Zudem seien viele Daten aus Datenschutzgründen einem breiten Publikum nicht zugänglich und könnten deshalb für die dringend nötige Sensibilisierung der Öffentlichkeit nicht genutzt werden.
«Wer will, sucht Wege. Wer nicht will, sucht Gründe (nichts zu tun)», schloss einer der Referenten seinen Vortrag. Insgesamt waren sich die Teilnehmenden einig, dass es in allen drei Bereichen mehr Mut zum Risiko brauche und dass ein Warten auf die perfekte Lösung oft kontraproduktiv sei.
Die Bedeutung des schnellen Handelns legte die Stadt Zürich anhand des Ausbaus ihrer thermischen Netze dar. Der Vergleich zwischen einem optimierten konventionellen Ausbau (90% CO2-neutral) und einem «ideologischen» Ausbau (100% CO2-neutral) zeigt, dass der Endausbau der 2. Variante mindestens drei Jahre später erfolgen würde. Damit wäre diese Variante erst 2048 bezüglich des Gesamt-CO2-Ausstosses im Vorteil. Fazit der Stadt: Variante 1 mit möglichen späteren Nachbesserungen sei daher vorzuziehen.
Im Verlaufe des Netzwerktreffens wurde auch deutlich, dass schnelles Handeln einen intensiveren Austausch mit allen Betroffenen und Anspruchsgruppen erfordert. Denn, wie es sich im Workshop zur Mobilität zeigte, bedeutet eine nachhaltige Mobilität nicht einfach einen Umstieg auf Elektroautos, sondern heisst insgesamt weniger Mobilität mit dem eigenen Auto oder sogar weniger Mobilität an sich. Und dies wäre, wie Vieles im Bereich der Energiewende, nur durch einen weit(er)reichenden Dialog mit allen Interessierten zu erreichen.

Mit welchen Schritten können Schweizer Gemeinden die Energiewende schaffen? Probleme und Lösungsansätze wurden an der Empa Akademie gemeinsam diskutiert. Bild: Empa

So bauen wir unser Energiesystem um: Forschung auf drei Ebenen. Grafik: Empa

Sanierungsmassnahmen: Optimale Lösungen nach Baujahr. Grafik: Empa
Aktuelles
Wie sähe der Strassenraum aus, wenn eine Stadt die Hälfte ihrer Verkehrsflächen fürs Radfahren und E-Biken zur Verfügung stellte? Benutzten Städter:innen dann häufiger ihr Rad? Wäre die E-Bike-City gar ein Ansatz, um die verkehrsbedingten CO2-Emissionen zu senken?
Diese Fragen untersuchen neun Professuren der ETH Zürich und der EPF Lausanne seit gut anderthalb Jahren. Den Lead dieser Forschungsinitiative hat der Verkehrsforscher Kay Axhausen, der im Januar 2024 emeritiert wird (vgl. Box). Jetzt liegen die ersten Erkenntnisse vor, und die Forschenden haben ihre Lösungsansätze anschaulich mit Visualisierungen aufbereitet und diese Woche auf einer Storymap-Website veröffentlicht. Mittels Storymapping lässt sich die Vision der E-Bike-City leicht verständlich als Geschichte in Text und Bild nachvollziehen.
Die E-Bike-City-Vision sieht vor, dass die Menschen künftig die Hälfte des städtischen Strassenraums nutzen können, wenn sie zu Fuss unterwegs sind oder per Fahrrad, E-Bike, Lastenrad, E-Scooter oder mit anderen Kleinverkehrsmitteln (sog. Mikromobilität). Heute sind über 80 Prozent des städtischen Strassenraums für Autos und Parkplätze reserviert. Nur rund 11,7 Prozent sind für E-Bikes und Fahrräder vorgesehen. Zumeist teilen sich Radfahrende und E-Biker:innen die Strassen mit den Autos.
Im Unterschied dazu wären die Fahrspuren für Autos, öffentlichen Verkehr (Trams, Busse), Zweiräder (Velos, E-Bikes) sowie die Gehwege für Fussgänger:innen in der E-Bike-City grundsätzlich voneinander getrennt. Dafür müsste kein zusätzlicher Strassenraum neu gebaut werden, sondern der bestehende würde umgebaut. Das innerstädtische Autostrassennetz bestünde in der E-Bike-City weitestgehend aus einspurigen Einbahnstrassen. Die Fahrspuren für die Räder und E-Bikes befänden sich in der Regel links und rechts der Einbahnstrasse. Der öffentliche Verkehr wiederum führe weiter auf den bestehenden, separaten Fahrspuren. «Eine derartige Neugestaltung gäbe den Menschen mehr Raum zurück», sagt Kay Axhausen.
Um die Neuerungen der E-Bike-City so realistisch wie möglich darzustellen, haben die Forschenden drei typische Beispiele aus der Stadt Zürich ausgewählt: Das Bellevue und die Quaibrücke beim Zürichsee, die Birchstrasse in Zürich-Nord und die Winterthurer-/Letzistrasse in Zürich-Oberstrass. An diesen Beispielen zeigen sie, wie anders ein Strassenraum aussähe, wenn er rad- statt autofreundlich gestaltet wäre. Mit einem Bildschieberegler lassen sich der heutige Strassenraum und der mögliche zukünftige Zustand direkt miteinander vergleichen.
Der Entwurf der E-Bike-City folgt bestimmten Gestaltungsprinzipien: Ausgehend vom bestehenden Strassennetz wird jeweils die eine Hälfte jeder Strasse zu einer sicheren und komfortablen Fahrradstrasse umgebaut, die mit dem Rad, Elektrorad, Lastenrad, Elektrotretroller etc. befahren wird. Die andere Hälfte der Strasse dient nach wie vor den Autos (Benzin oder Batterie), sodass die Zufahrt zu Wohn- und Bürogebäuden gewährleistet ist.
Auf ihrer Storymap-Website zeigen die ETH-Forschenden am Beispiel des Zürcher Bellevues und der Quaibrücke, wie sich die E-Bike-City-Prinzipien in vier Schritten realisieren liessen:
Neben diesen Schlüsselmassnahmen untersuchen die ETH- und EPFL-Forschenden weitere Begleitmassnahmen. Zum Beispiel könnte die Umstellung auf ein städtisches Einbahnstrassennetz die Autos stauen. Diese Stau-Wahrscheinlichkeit liesse sich mit einer dynamischen Strassennutzung senken. Dabei würde je nach Tageszeit mittels Lichtsignalen gesteuert, in welcher Richtung die Autos und Fahrräder jeweils die Strasse benutzten und wie viele Fahrspuren sie nutzen könnten. Auch die Akzeptanz der E-Bike-City wird untersucht. Zum Beispiel könnten sich Autofahrende benachteiligt sehen, wenn der Radverkehr bevorzugt gefördert wird. «Im Forschungsprojekt überprüfen wir, wie tragfähig und kostendeckend die Grundannahme und die Prinzipien der E-Bike-City sind, und welche Voraussetzungen für einen möglichen Umbau nötig sind», sagt Kay Axhausen.
Für Kay Axhausen markiert das E-Bike-City-Projekt zugleich das Ende seiner Laufbahn als Professor für Verkehrsplanung an der ETH Zürich, auch wenn er dieses Projekt über seine Emeritierung hinaus betreuen wird. 1999 wurde er an die ETH berufen. Seinen Ruf erwarb er sich als Forscher, der Verkehrsfragen mit scharfem analytischen Blick sowie mit präzisen, ökonomischen und mathematischen Modellen auf den Grund geht.
Namentlich das Transportsimulationssystem MATSim, das er mit seiner Forschungsgruppe in den vergangenen 20 Jahren mitentwickelte, hat, wie Axhausen sagt, «eine grosse, durchschlagende Wirkung erreicht.» Heute kann MATsim zahlreiche Aspekte des Verkehrsverhaltens simulieren. «Die grösste Anwendung, die wir derzeit in vernünftiger Rechenzeit simulieren können, umfasst ganz Deutschland, also die Verkehrsentscheidungen von 85 bis 90 Millionen Menschen.»
«Unsere Vision ist es, dass die Stadt der Zukunft bequemer, leiser, grüner und gesünder wird als heute.»
– Kay Axhausen
Fragen der Verkehrsplanung sind nie ausschliesslich wissenschaftlicher Natur, da ihre Umsetzung letzten Endes immer eine politische Entscheidung erfordert. MATSim und E-Bike-City stehen in dieser Hinsicht sinnbildlich für zwei Haltungen, wie der Forscher mit der Nähe zur Politik umgehen kann. MATSim und die Modellierung des Verkehrsverhaltens verdeutlichen das Selbstverständnis des Grundlagenforschers, der die Verkehrspolitik im Hintergrund unterstützt. E-Bike-City auf der anderen Seite steht für die Hinwendung zu Politik und Gesellschaft, bei der der Forscher neue Ideen für die politische Debatte entwickelt sowie Lösungsansätze und Handlungsoptionen aufzeigt.
«Als Forscher habe ich mich bislang nie direkt in die verkehrspolitische Debatten eingebracht», sagt Axhausen, «mit dem E-Bike-City-Projekt ist das anders, da bringen wir uns tatsächlich aktiver in die Verkehrspolitik ein.» Zum Beispiel wurden die Storymap-Website und die Erkenntnisse der E-Bike-City diese Woche Simone Brander vorgestellt, die im Zürcher Stadtrat für den Verkehr zuständig ist. Dieses Engagement hat sehr viel mit dem Klimawandel zu tun, der viele Verkehrsprobleme wie das klassische Stau-Problem überschattet, und neue Lösungsansätze erfordert.
«Mit Blick auf die Erderwärmung können wir in der Verkehrsplanung nicht wie bisher weitermachen. Wir brauchen neue verkehrspolitische Ideen für die Städte. Die E-Bike-City ist auch ein Modell, wie der Verkehr seine Treibhausgasemissionen reduzieren kann», sagt Axhausen, «die E-Bike-City soll zeigen, dass Fahrrad und E-Bike als Standardverkehrsmittel in der Stadt dienen können. Unsere Vision ist es, dass die Stadt bequemer, leiser, grüner und gesünder wird als heute.»

(Bild: ETH Zürich / mattership)

Mehr Raum für die Fussgänger:innen und Radfahrer:innen – so könnte eine Strassenkreuzung in Zürich aussehen, wenn sie nach den Prinzipien der E-Bike-City gestaltet würde. (Bild: ETH Zürich/L. Ballo, IVT)

Ansicht einer Kreuzung in der E-Bike-City: Zweiräder erhalten eine eigene Doppelspur und auch der öV benutzt seine eigene Spur. Die Autos fahren auf Einbahnstrassen. (Bild: ETH Zürich/L. Ballo, IVT)

In der E-Bike-City besteht das innerstädtische Autostrassennetz weitestgehend aus Einbahnstrassen, wohingegen die Zweiräder eigene Fahrspuren für beide Fahrtrichtungen erhalten. (Bild: ETH Zürich/L. Ballo, IVT)

Mit der Umsetzung der E-Bike-City-Prinzipien wären auch Einsparungen möglich. (Infografik: ETH Zürich / mattership)
Aktuelles
Die Schlieremer Kuros Biosciences AG hat von der amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung für die Verwendung von MagnetOs Flex Matrix im interkorporellen Bereich erhalten. Laut Medienmitteilung kann MagnetOs Flex Matrix nun in jedem interkorporellen Raum wie Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule oder Lendenwirbelsäule und in jedem sogenannten Cage verwendet werden, der für die Verwendung mit einem Knochenersatzmaterial zugelassen ist. Ein Cage dient etwa in der Wirbelsäule als Abstandshalter anstelle einer nicht mehr funktionierenden Bandscheibe.
Interkorporelle Cages kommen nach Angaben von Kuros bei fast der Hälfte der schätzungsweise 1,5 Millionen instrumentierten Wirbelsäulenfusionen, die jährlich in den USA durchgeführt werden, zum Einsatz. MagnetOs Flex Matrix sei für interkorporelle Anwendungen besonders gut geeignet, da es aufgrund seiner hervorragenden Granulatrückhaltung selbst in feuchtem Zustand stabil und flexibel bleibt und sich daher entweder über einen Trichter oder direkt in einen Cage jeder Grösse einbringen lässt, heisst es weiter.
„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen und für die chirurgische Gemeinschaft. Mit dieser Freigabe haben wir eine beträchtliche Chance, Chirurgen wieder zu erreichen, die bisher nicht in der Lage waren, unser MagnetOs Flex Matrix-Produkt für interkorporelle Eingriffe zu verwenden“, wird Chris Fair zitiert, der CEO von Kuros.
Kuros Biosciences AG ist eine Ausgründung aus der Universität Zürich (UZH) und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH). Das Unternehmen hat seinen Sitz im Bio-Technopark Schlieren-Zürich. ce/gba

Kuros hat in den USA die Zulassung für die Verwendung von MagnetOs Flex Matrix im interkorporellen Bereich erhalten. Symbolbild: ckstockphoto/Pixabay
Aktuelles
Die auf Frühgeburtsdiagnostik spezialisierte Pregnolia AG hat laut einer Mitteilung auf LinkedIn eine Finanzierungsrunde über 2,2 Millionen Franken erfolgreich abgeschlossen. Damit will das Unternehmen sein Messgerät zur Erkennung von Frühgeburtsrisiken zu einem Diagnosesystem ausbauen und den Zugang zum Markt in den USA erschliessen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Pregnolia hat ein Messgerät entwickelt, das eine zuverlässige Erkennung von Frühgeburtsrisiken bietet. Dabei misst eine Sonde die Festigkeit des Gebärmutterhalses. Wenn dieser zu weich ist, kann der Arzt rechtzeitig therapeutische Massnahmen einleiten.
Sabrina Badir, CEO von Pregnolia, habe früh erkannt, dass die Steifigkeit der Zervix ein äusserst zuverlässiger Indikator für eine mögliche Frühgeburt ist, heisst es in der Mitteilung des Start-ups. „Eine weiche Zervix korreliert mit einer Frühgeburt. Dieser Sachverhalt wird inzwischen durch mehrere laufende Studien bestätigt. Zwei davon wurden an der diesjährigen internationalen Fachtagung für die spontane Frühgeburt in Holland präsentiert“, wird Badir zitiert.
Das als Ausgliederung aus der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) gegründete Start-up sei nun daran, dieses Gerät zu einem Frühgeburtsdiagnostiksystem auszubauen, das der Ärztin und dem Arzt unmittelbar anzeigt, wie hoch das Risiko einer Schwangeren ist, eine spontane Frühgeburt zu erleiden. Dazu baue Pregnolia eine breite Datenbasis der Zervix-Steifigkeitswerte von normal Schwangeren sowie von Schwangeren mit frühzeitigen Wehen oder traditionellen Risiken in Zusammenarbeit mit Spezialisten in Deutschland, Grossbritannien, den Niederlanden und Italien auf.
Mit dem frischen Kapital sollen die Kosten der laufenden klinischen Studien sowie die Aufbereitung der Daten finanziert werden, ebenso die Vorbereitung der Zulassung des Pregnolia-Diagnosesystems für den amerikanischen Markt. ce/gba

Pregnolias Messgerät ermöglicht eine zuverlässige Erkennung von Frühgeburtsrisiken. Bild: Carlo Navarro via unsplash
Aktuelles
Die Innovationsagenturen der Schweiz, Israels, Schwedens und Singapurs haben über Eureka, das weltweit grösste öffentliche Netzwerk für internationale Zusammenarbeit in Forschung, Entwicklung und Innovation, einen gemeinsamen Aufruf publiziert: Noch bis zum 26. Februar suchen sie innovative Entwicklungs- und Forschungsprojekte, die Alternativen zu Proteinen von lebenden Tieren fördern.
Der Schwerpunkt liegt laut der Ausschreibung auf pflanzlichem, fermentativ gewonnenem sowie kultiviertem Fleisch und Meeresfrüchten. Auch Hybridprodukte und Basistechnologien wie die molekulare pflanzliche Landwirtschaft fallen in den Geltungsbereich.
Die Höhe der zugesagten Fördermittel unterscheidet sich etwas von Land zu Land. Für die Schweiz sagt Innosuisse für Start-ups bis zu 70 Prozent der Projektkosten, für KMU bis zu 50 Prozent und für Grossunternehmen bis zu 25 Prozent Zuschuss zu. Universitäten und Forschungseinrichtungen können auf bis zu 100 Prozent zählen.
Der Aufruf setzt auf Kooperationen zwischen mindestens zwei der teilnehmenden Länder: Das werde „die nachhaltige Lebensmittelproduktion steigern, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stärken, neue Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und das zukünftige Qualifikationsangebot entwickeln“. Zudem könne eine internationale Zusammenarbeit „grössere Exportmöglichkeiten sowie eine höhere Selbstversorgungs-, Widerstandsfähigkeits- und Bereitschaftsrate ermöglichen“. Das Projekt muss allen beteiligten Partnern zugutekommen. Seine maximale Laufzeit darf 36 Monate nicht überschreiten.

Aktuelles
Die Universität Zürich will bis 2030 klimaneutral werden. Mit breitgefächerten Massnahmen trägt sie in Forschung und Lehre, im Betrieb sowie im Austausch mit der Gesellschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Konkrete Beispiele hierzu sind etwa die Universitären Forschungsschwerpunkte, die sich mit globalem Wandel, Ökosystemen oder Biodiversität auseinandersetzen; der neue Studiengang «Biodiversität», der Nachhaltigkeitskompetenzen in das reguläre Lehrangebot integriert; die Studienwoche «Nachhaltige Entwicklung und Transformation», die transdisziplinäres Lernen ermöglicht; die Ringvorlesung «Nachhaltigkeit jetzt!», die Problemfelder mit der Öffentlichkeit diskutiert; oder die Aktionspläne der Fakultäten, um die flugbedingten Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren.
Nun ergänzt die UZH ihre bisherigen Nachhaltigkeitsbestrebungen mit einem neuen Förderinstrument. Zu Beginn dieses Jahres konnten UZH-Angehörige Ideen für sogenannte Reallabor-Projekte einreichen, um zu erforschen, wie die UZH ihre Treibhausgas-Emissionen senken kann. «Die UZH stellt sich ihren Angehörigen als Reallabor zur Verfügung, um innovative Massnahmen für einen nachhaltigen Betrieb zu ermöglichen. Sie fördert damit inter- und transdisziplinäre Forschungsansätze im Nachhaltigkeitsbereich», sagt Elisabeth Stark, Prorektorin Forschung.
Mit den Reallabor-Projekten wird die UZH selbst zum Forschungsobjekt. Zentral dabei ist, dass Forscherinnen und Forscher mit technischen oder administrativen Mitarbeitenden zusammenarbeiten. Das ist für viele ungewohnt. «Für das Klimaneutralitätsziel der UZH müssen wir bestehende Prozesse und Gewohnheiten überdenken. Die Reallabor-Projekte verknüpfen Wissenschaft und Praxis und helfen so zu verstehen, welche Anpassungen tatsächlich zu einer Verringerung klimaschädlicher Emissionen beitragen», erklärt Gabriele Siegert, Vize-Rektorin und Prorektorin Lehre und Studium.
Auch Lorenz Hilty, UZH-Delegierter für Nachhaltigkeit, hält es für zukunftsweisend, Forschung und betriebliche Abläufe aufeinander zu beziehen: «Die UZH lernt, wissenschaftliche Erkenntnisse auf sich selbst anzuwenden und gewinnt zugleich Wissen über die eigenen Strukturen und Prozesse.»
Eine Jury – bestehend aus Vertreter:innen der Fakultäten und Zentralen Dienste – prüfte die Eingaben. Von acht eingereichten Projekten erfüllten fünf die Kriterien am besten, weil sie unter anderem eine signifikante Reduktion von Treibhausgas-Emissionen erwarten lassen, auf transdisziplinärer Forschung beruhen und das Potenzial haben, von anderen UZH-Organisationseinheiten oder externen Institutionen übernommen zu werden.
Die UZH unterstützt diese fünf Reallabor-Projekte mit insgesamt rund 228 000 Franken – wobei sich die Fördersumme je nach Projekt stark unterscheidet. «Neben sogenannten Pionierprojekten, die unmittelbar Emissionen reduzieren, wollten wir auch kleinere Projekte unterstützen, die zunächst das Monitoring von Entwicklungen verbessern oder Entscheidungen vorbereiten», erklärt Lorenz Hilty. Die geförderten Projekte dauern zwischen sechs und 24 Monate. Erste Resultate werden auf Mitte nächstes Jahr erwartet. Ein ausführlicher Beschrieb der Reallabor-Projekte und ihrer Beteiligten findet sich auf der Website.

Wie kann die Vegetation des Campus Irchel möglichst nachhaltig bewirtschaftet werden? Ein UZH-Projektteam erforscht dies in den nächsten Monaten. (Bild: Stefan Walter)

Plastikpipetten waschen anstatt wegwerfen, kann das funktionieren? Ein UZH-Projektteam will dies herausfinden. (Bild: Ursula Meisser)
Aktuelles
Das Boston Dynamics AI Institute wird Anfang 2024 ein Entwicklungsteam in Zürich installieren. Damit will die in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts ansässige und auf Künstliche Intelligenz (KI) fokussierte Organisation laut einer Medienmitteilung ihr weiteres Wachstum unterstützen und die besten Talente Europas anziehen.
„Das Zürcher Team wird den Fokus des Instituts auf Kernbereiche wie KI, Hardware-Design, Maschinelles Lernen, geschickte mobile Manipulation und Roboterethik ausweiten und uns dabei helfen, Kontakte zu Talenten, Universitäten und Forschungsorganisationen im dynamischen europäischen Ökosystem zu knüpfen.“ Gemäss der Angaben des Instituts ist seine Kultur darauf ausgelegt, die besten Eigenschaften akademischer und privater Forschungslabors zusammenzuführen.
Das Boston Dynamics AI Institute wurde im August 2022 von Marc Raibert ins Leben gerufen. Er hatte 2013 bereits Boston Dynamics gegründet, ein Robotik-Unternehmen mit Sitz in Waltham, das vor allem hinsichtlich autonomer Laufroboter forscht und entwickelt, zu Beginn für das US-Militär. 2020 wurde Boston Dynamics von der Hyundai Motor Company übernommen.
Hyundai und Boston Dynamics haben laut einer Mitteilung zum Start des Boston Dynamics AI Institute zunächst mehr als 400 Millionen Dollar investiert. Im ersten Jahr seiner Tätigkeit hat das Institut seine Forschungs-, Technik- und Betriebsteams auf über 150 Mitarbeitende und zehn Gastprofessorinnen und -professoren aufgestockt, die auf über 100'000 Q

Das Boston Dynamics AI Institute wird ab Anfang 2024 mit einem Entwicklungsteam in Zürich präsent sein. Bild: zVg/Boston Dynamics AI Institute
Aktuelles
In den vergangenen Jahren entwickelten Ingenieure der ETH Zürich eine Technologie, um aus Sonnenlicht und Luft Flüssigtreibstoffe herzustellen. 2019 demonstrierten sie erstmals den gesamten Prozess unter realen Bedingungen mitten in Zürich, auf dem Dach des Maschinenlaboratoriums der ETH. Solche synthetischen solaren Treibstoffe sind CO2-neutral, da sie bei der Verbrennung genauso viel CO2 freisetzen, wie der Luft zu ihrer Herstellung entzogen wurde. Bereits sind die ETH-Spin-offs Climeworks und Synhelion daran, die Technologie weiterzuentwickeln und zu kommerzialisieren.
Kernstück des Herstellungsprozesses ist ein Solarreaktor, auf den mit einem Parabolspiegel konzentrierte Sonnenstrahlung gerichtet wird, und der dadurch auf bis zu 1500 Grad Celsius aufgeheizt wird. In diesem Reaktor, der eine poröse Struktur aus Ceroxid enthält, läuft eine zyklische thermochemische Reaktion ab zur Spaltung von Wasser und CO2, das zuvor aus der Luft abgeschieden wurde. Es entsteht dabei Syngas, ein Gemisch aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid, das zu flüssige Kohlenwasserstoff-Treibstoffe wie zum Beispiel dem von Flugzeugen verwendeten Kerosin (Flugbenzin) weiterverarbeitet werden kann.
Bisher nutzten die Forschenden dazu eine Struktur mit gleichmässiger Porosität. Das hat jedoch einen Nachteil: Die einfallende Sonnenstrahlung schwächt sich auf dem Weg ins Innere des Reaktors exponentiell ab. Dadurch werden im Innern nicht so hohe Temperaturen erreicht, was die Leistung des Solarreaktors begrenzt.
Nun haben Forschende aus der Gruppe von André Studart, ETH-Professor für komplexe Materialien, und der Gruppe von Aldo Steinfeld, ETH-Professor für Erneuerbare Energieträger, eine neuartige 3D-Druckmethode entwickelt. Sie können damit Keramikstrukturen mit komplexen Poren-Geometrien zu erzeugen, welche einen effizienteren Transport der Sonnenstrahlung ins Reaktorinnere ermöglichen. Das Forschungsprojekt wird vom Bundesamt für Energie gefördert.
Als besonders effizient entpuppt haben sich hierarchische Strukturen mit Kanälen und Poren, deren sonnenexponierte Oberflächen offener sind und die zum hinteren Ende des Reaktors dichter werden. Diese Anordnung ermöglicht es, konzentrierte Sonnenstrahlung über das gesamte Volumen zu absorbieren. Dadurch erreicht auch die gesamte poröse Struktur die Reaktionstemperatur von 1500 Grad und trägt zur Treibstofferzeugung bei. Die Forschenden stellten die Strukturen mittels einer extrusionsbasierten 3D-Drucktechnik. Als druckbare Tinte verwendeten sie eine neue für diesen Zweck entwickelte Paste. Diese verfügt über Eigenschaften, die sie für diese Herstellungsmethode besonders geeignet macht: Sie ist wenig viskos und enthält eine hohe Konzentration von Ceroxidpartikeln, um die Menge an reaktionsfähigem Material zu maximieren.
Erste Tests erfolgreich
Die Forschenden untersuchten schliesslich das komplexe Zusammenspiel zwischen der Übertragung der Strahlungswärme und der thermochemischen Reaktion. So konnten sie zeigen, dass sich mit ihren neuen hierarchischen Keramikstrukturen im Vergleich zu den bisherigen uniformen Strukturen bei gleicher konzentrierter Sonnenstrahlung, die der Intensität von 1000 Sonnen entspricht, doppelt so viel Treibstoff herstellen lässt. Die Technologie zum 3D-Druck der Keramikstrukturen ist bereits patentiert, Synhelion hat die Lizenz von der ETH Zürich erworben. «Diese Technologie hat das Potenzial, die Energieeffizienz des Solarreaktors deutlich zu steigern und damit die Wirtschaftlichkeit von nachhaltigen Flugtreibstoffen erheblich zu verbessern», betont Aldo Steinfeld.

Die Illustration zeigt eine 3D-gedruckte Ceroxidstruktur mit hierarchischer Kanalarchitektur. Konzentrierte Sonnenstrahlung fällt auf die Struktur und treibt die solare Aufspaltung von CO2 (links im Bild) in getrennte Ströme von CO und O2 voran. (Grafik: aus Advanced Materials Interfaces (Band 10, Nr. 30, 2023) https://doi.org/10.1002/admi.202300452)
Aktuelles
Würden Sie bei einer Operation einen angehenden Chirurgen, eine angehende Chirurgin einen Eingriff an Ihrem Körper üben lassen? Die meisten Menschen dürften die Frage, wenn überhaupt, wohl mit einer gewissen Skepsis bejahen. Doch auf die Bereitschaft der Patientinnen und Patienten war man in der Ausbildung in der Vergangenheit angewiesen: Im Modell «See one, do one, teach one» eigneten sie sich das Handwerk an, indem sie einen Eingriff erst beobachteten, diesen dann selbst durchführten und ihn schliesslich Mitstudierenden vorführten. Das sei längst nicht mehr zeitgemäss, wie Bruno Schmied vom Kantonsspital St.Gallen (KSSG) sagt. «Der Ansatz geht zulasten der Patientinnen und Patienten, die einem Risiko ausgesetzt werden», sagt der Chefarzt Chirurgie. Ausserdem koste das Assistieren viel Zeit. «Eine OP, bei der assistiert wird, dauert 20 bis 30 Prozent länger», erläutert Schmied. «Das geht immens ins Geld – denn der OP-Saal ist der teuerste Ort in einem Spital.»
Flagship-Projekt von Innosuisse
Das KSSG leitet als eine von drei klinischen Partnerinnen das 2022 gestartete Projekt «Proficiency», mit dem die chirurgische Ausbildung in der Schweiz umfassend modernisiert wird. Hand in Hand mit einer umfassenden Aktualisierung der entsprechenden Curricula werden die Weiterbildungen für angehende Fachärztinnen und -ärzte mit modernsten Simulationstechnologien wie Virtual-Reality-Anwendungen (VR), Augmented-Reality-Brillen (AR) oder High-End-Simulatoren bis Anfang 2025 komplett neu gestaltet. An dem Innosuisse-Flagship-Projekt, das von der nationalen Innovationsagentur mit 12 Millionen Franken gefördert wird, sind neben den drei Spitälern mehrere Unternehmen sowie die ZHAW, die ETH Zürich und die Universität Zürich (Balgrist) beteiligt.
«Die im Programm integrierten Technologien eröffnen ganz neue Möglichkeiten», sagt Helmut Grabner von der ZHAW School of Engineering. Der Professor für Data Analytics and Machine Learning und stellvertretende Leiter des ZHAW-Teilprojekts nennt als Beispiel die High-End-Infrastruktur im Operating Room X (OR-X) an der Universitätsklinik Balgrist. Die Simulationsinfrastruktur in dem hypermodernen Lehr- und Forschungszentrum erlaubt die realitätsgetreue Ausbildung und das Training von Ärztinnen und Ärzten. «Hier können sie sich die chirurgischen Skills ohne Risiken aneignen. Das Setting ermöglicht zudem, Eingriffe zu üben, die bei echten Menschen zuerst durch die Ethikkommission bewilligt werden müssten.»
Nachbildungen von Organen
Neben High-End-Plattformen wie dem OR-X umfasst das Projekt auch einfachere Anwendungen, etwa Box Trainer. Dabei handelt es sich um Nachbildungen von Organen oder Körperregionen, an denen beispielsweise minimalinvasive Eingriffe geübt werden können. In Kombination mit einem Smartphone oder Laptop können solche Box Trainer auch zu Hause verwendet werden und stellen damit eine niederschwellige Trainingsmöglichkeit dar. «Das Projekt Proficiency sieht vor, dass angehende Chirurginnen und Chirurgen beim Einüben eines Eingriffs eine Journey durchlaufen – von Low-End- hin zu High-End-Simulationen», erklärt Philipp Ackermann, ZHAW-Projektleiter und stellvertretender Leiter für Human-Centered Computing an der School of Engineering. Chirurgische Eingriffe liessen sich mit dem Gitarrenspielen vergleichen. «Das Handwerk lernt man nicht durchs Zuschauen – man muss üben, üben, üben.» Erst durch das wiederholte Durchführen von Handgriffen bildeten sich die Muscle Memory und damit auch die Fähigkeiten, die Chirurginnen und Chirurgen im OP benötigten.
Die Simulationen für verschiedene Eingriffe werden von den Unternehmen und den Hochschulen gemeinsam entwickelt. Die ZHAW nehme dabei eine «Brückenfunktion» ein, sagt Ackermann. «Wir arbeiten etwa die von der ETH entwickelten Algorithmen ins Projekt ein.» Zudem ist das Team der School of Engineering für das Tracking der chirurgischen Instrumente in den Simulationen zuständig. «Wir sorgen dafür, dass die Instrumente in AR oder VR korrekt verortet sind.» Ausserdem arbeitet das Team am Grading der Bewegungen, also an Skalen, mit denen die Bewegungen während eines Eingriffs abgestuft beurteilt werden können. «Das Grading ermöglicht ein datenbasiertes und damit objektives Feedback – mit Proficiency kommt man weg vom ärztlichen Urteil, bei dem das Risiko von Willkür und Zufälligkeit besteht», führt Helmut Grabner aus.
Nach Anfangsinvestitionen günstiger
Für Chefarzt Bruno Schmied werden die Assistenzärztinnen und -ärzte die Hauptgewinner des neuen Ausbildungsmodells sein – nicht nur, weil es eine faire Beurteilung erlaubt. «Mit der Standardisierung kann man das Beste aus allen angehenden Chirurginnen und Chirurgen herausholen. Sie berücksichtigt die individuellen Skills und Schwächen.»
Laut Schmied ermöglicht es «Proficiency» zudem, die Weiterbildung künftig schneller abzuschliessen – einfach weil Eingriffe viel öfter geübt werden können. «Bedenkt man, dass Chirurginnen und Chirurgen 40 bis 45 Jahre alt sind, wenn sie den Facharzttitel erhalten, ist das ein starker Anreiz», so Schmied. Insgesamt bezeichnet er das neue Weiterbildungsmodell als «Win-win-win-Situation». Neben den Assistenzärztinnen und -ärzten sowie den Kranken profitierten auch die Spitäler von der simulationsbasierten Weiterbildung. «Spitäler, viele von ihnen defizitär, kostet die Weiterbildung von Chirurginnen und Chirurgen primär Geld.» Und aufgrund der Fallpauschalen könnten sie diese Kosten nicht verrechnen.
Überregionale Zentren für die Ausbildung
Der Kostendruck ist auch eine der Haupthürden bei der Umsetzung. «Wenn es um Investitionen für Equipment, Arbeitsplätze und Arbeitskräfte für die Weiterbildung geht, wird es schwierig», erklärt Bruno Schmied. Die Lösung liege in überregionalen Zentren, «damit nicht in jedem Spital teure Simulatoren stehen müssen». Und in Low-Cost-Plattformen wie den Box Trainern, mit denen Assistenzärztinnen und -ärzte niederschwellig und kostengünstig trainieren könnten.
«Proficiency» benötige gewisse Anfangsinvestitionen. «Danach ist die Weiterbildung aber deutlich günstiger als bisher», so Schmied. Das scheint auch den Spitälern bewusst zu sein. So zeigte eine im Rahmen des Projekts durchgeführte Umfrage unter den weiterbildungsbeteiligten Spitälern grosses Interesse an der Modernisierung der Curricula und am Einsatz von Simulationstechnologien.

Im modernen Lehr- und Forschungszentrum OR-X der Universitätsklinik Balgrist werden die Chirurginnen und Chirurgen von morgen ausgebildet – schneller und besser. (Bild: Daniel Hager)
Aktuelles
Auf Circunis können ab sofort überschüssige Lebensmittel gehandelt werden. Betriebe können ihre Überschüsse auf der Plattform anbieten oder gezielt nach benötigtem Schweizer Obst und Gemüse suchen. Der B2B-Marktplatz des Zürcher Vereins Mehr als zwei schafft damit erstmals eine landesweite Grundlage dafür, dass die Lebensmittel im Kreislauf verbleiben statt auf dem Müll zu landen. Damit will Circunis zum nationalen Ziel beitragen, Food Waste bis 2030 zu halbieren.
„Die meisten Betriebe möchten nachhaltiger wirtschaften“, wird CEO und Co-Gründerin Olivia Menzi in einer Medienmitteilung zitiert. „Circunis bietet jetzt das dafür nötige Netzwerk – und das sehr einfach und schnell.“ Erste Erfolgsgeschichten aus der Pilotphase zeigten, dass der Ver- und Ankauf überschüssiger Lebensmittel nicht nur nachhaltig und daher sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich lohnend ist. Als Kriterien dafür führt Circunis Stichwörter ins Feld wie zusätzlicher Ertrag statt Entsorgungskosten, freiwerdende Lagerflächen, zeitliche Einsparungen und attraktive Einkaufsbedingungen.
Ermöglicht wird die Umsetzung des Projekts durch den Migros-Pionierfonds und die Seedling Foundation. Die Jahresgebühr für die Nutzung des B2B-Marktplatzes orientiert sich am betrieblichen Umsatz und startet bei 250 Franken. Neue Teilnehmende erhalten bis Ende September 2024 einen Rabatt von 50 Prozent auf die erste Jahresgebühr. ce/mm
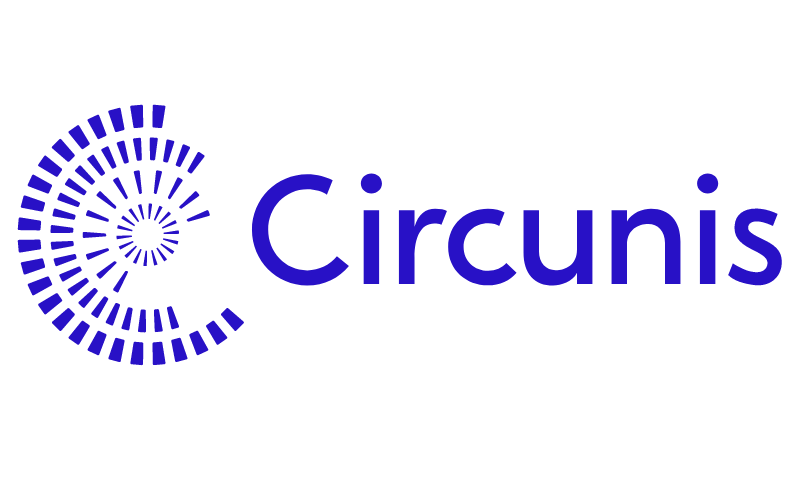

Das Team hinter Circunis v.l.n.r: Fiona Wicki, Olivia Menzi, Corina Koster, Micha Krautwasser und Karin Friedli. Bild: Circunis
Aktuelles
Tiefgekühltes Schweizer Gemüse, Früchte und Hülsenfrüchte sind nur einige der über 60 Tonnen Lebensmittel, die zum Start auf dem B2B-Marktplatz Circunis erfasst sind. Betriebe können ihre Überschüsse nicht nur erfassen, sondern auch gezielt nach benötigten Lebensmitteln suchen. Dadurch wird Lebensmittelüberschuss schweizweit auf einfache Art sicht- und handelbar. Der Handel erfolgt direkt von Betrieb zu Betrieb. Circunis dient als Brückenbauer und vernetzt Produzent*innen, Lebensmittelverarbeitung, System- und Care-Gastronomie sowie den Grosshandel.
«Die meisten Betriebe möchten nachhaltiger wirtschaften. Circunis bietet jetzt das dafür nötige Netzwerk – und das sehr einfach und schnell», betont Co-Gründerin Olivia Menzi.
Nachhaltige und wirtschaftliche Vorteile für Teilnehmer*innen
Dass der Verkauf oder Ankauf von Lebensmittelüberschuss nicht nur nachhaltig sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich lohnenswert ist, zeigen erste Erfolgsgeschichten aus der Pilotphase: zusätzlicher Ertrag statt Entsorgungskosten, frei werdende Lagerflächen, zeitliche Einsparungen und attraktive Einkaufsbedingungen.
Teilnehmer*innen bei Circunis haben vollen Zugang auf den B2B-Marktplatz circunis.ch und profitieren von einem einfach zugänglichen und schweizweiten Netzwerk. Die Jahresgebühr orientiert sich am betrieblichen Umsatz und startet bei CHF 250/Jahr.
Wichtige Grundlage für schweizweiten Kreislauf
Heute werden rund 40 % aller Lebensmittel weltweit überproduziert und landen im Abfall. Die Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensmittelüberschüsse bis 2030 zu halbieren. Der neue B2B-Marktplatz des Vereins Mehr als zwei schafft erstmals eine Grundlage, um einen schweizweiten Kreislauf im Umgang mit Überschuss zu etablieren. Ermögilcht wird die Umsetzung des Projekts vom Migros-Pionierfonds und Seedling Foundation.
→ Jetzt mehr erfahren auf circunis.ch und gemeinsam zu einer nachhaltigen Schweizer Lebensmittelwirtschaft beitragen. Neue Teilnehmer*innen erhalten bis Ende September 2024 einen Rabatt von 50 % auf die erste Jahresgebühr.
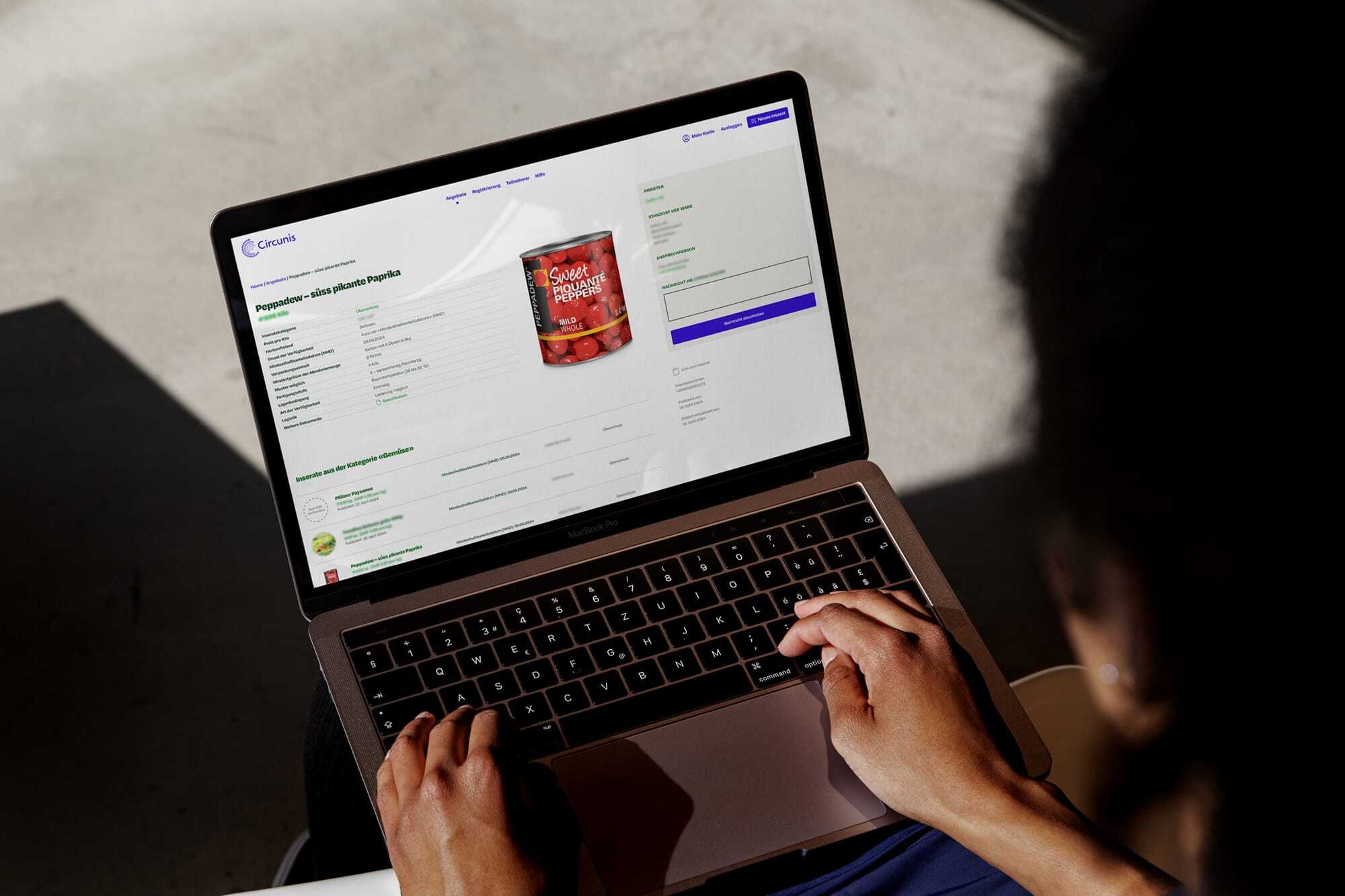
Dieses Video kommt von YouTube
Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.
Voices
Mario Jenni, Mitgründer und CEO vom Bio-Technopark Schlieren, gibt Einblicke in den Mehrwert von Inno-Hubs und erläutert, warum Innovation Zurich eine wichtige Rolle spielt.
Events

Events

(Titelbild: Pexels)
Aktuelles
Künstliche Intelligenz (KI) und ihre scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten gibt es bereits seit 70 Jahren. Heute ist das Thema allgegenwärtig: Insgesamt sieben Referate zum Thema der Bildungskonferenz „KI – Chance für die Bildung“ fokussierten auf den verantwortungsvollen Einsatz im Bildungsbereich. Philippe Wampfler und Christian Coenen gaben konkrete Handlungsempfehlungen und Tools, wie ein moderner Schulunterricht mit KI funktioniert.
Ist es beispielsweise noch sinnvoll einen Maturaaufsatz zu schreiben? KI könne dabei helfen, bessere Texte zu verfassen. „Schulprüfungen müssen angepasst werden“, empfiehlt Wampfler. Die Schüler:innen von morgen sollten wissen, wie sie die Tools zu ihrem Nutzen einsetzen können, ohne dabei den eigenen Lerneffekt und Kompetenzaufbau zu vernachlässigen. Für die Lehrpersonen wiederrum bedeutet dies eine bewusste Steuerung und didaktisches Know-how beim Einsatz von KI-Tools.
Keine Angst vor KI
Welche Einflüsse KI auf unsere Arbeitswelt haben wird, zeigte Klementina Pejic am Beispiel von Swisscom auf. Sie sprach offen über die Angst der Mitarbeitenden, eines Tages von einer KI ersetzt zu werden. Ihr Fazit: eine unbegründete Angst! Ted-Talk-Redner Manu Kapur rundete die Konferenz ab, indem er die generelle Zukunft des Lernens in Zeiten von KI illustrierte.
Was in allen Beiträgen der Konferenz deutlich wurde: Es geht nicht um die Frage, ob KI uns ersetzen wird, sondern vielmehr darum, wie wir KI so einsetzen, dass sie für uns ein hilfreiches Werkzeug sein kann.
Sponsoren der 14. Bildungskonferenz: Swisscom AG, u-blox AG, Hasler Stiftung, UBS und ZIS Zurich International School. Die Planung für die 15. Durchführung der Bildungskonferenz am 25. März 2025 hat bereits begonnen. Diese findet erneut im Gottlieb Duttweiler Institute in Rüschlikon statt.




Events
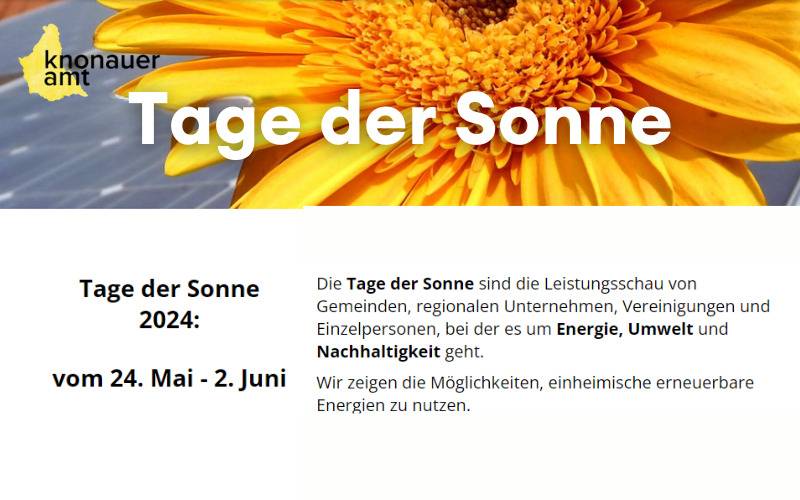
Aktuelles
Die Hashgraph Association (THA) aus dem Kanton Schwyz und Trust Square aus Zürich geben eine strategische Partnerschaft bekannt. Laut einer Medienmitteilung soll sie Unternehmerinnen, Unternehmern und Firmen alle notwendigen Einrichtungen, Werkzeuge und Technologien bieten, „um bahnbrechende Deep-Tech-Lösungen zu entwickeln, die die Konvergenz von KI, Blockchain/DLT, Robotik, IoT, VR und Quantencomputing nutzen“.
Ein erstes Ergebnis ihrer Kooperation ist die Eröffnung des Trust Square Coworking Innovation Space im Brannhof an der Zürcher Bahnhofstrasse. Zusätzlich zum Raum stellt diese Partnerschaft den Angaben zufolge auch Spitzentechnologien wie das DLT-Netzwerk von Hedera, Verbindung von Unternehmen, Start-ups, Technologie- und Dienstleistungsanbietern sowie gemeinsame Erkennung und Validierung von Anwendungsfällen.
Marc Degen, Mitgründer und Chairman von Trust Square, spricht von einer „aufregenden Gelegenheit“ für Start-ups und Unternehmende in der Schweiz: „Trust Square hat in der THA eine verwandte Seele gefunden: Wir beide sind bestrebt, Gründer, Unternehmen, Investoren und Akademiker zusammenzubringen und ihnen zu ermöglichen, ihre Visionen in einem offenen und vielfältigen Umfeld zu verfolgen.“
Die Partner beabsichtigen, weltweit Hubs aufzubauen. Dabei soll nach den Worten von Kamal Youssefi, dem Präsidenten der THA, die Schweiz mit dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum verbunden werden. „In Kürze werden wir unser DeepTech Venture Studio in Saudi-Arabien über Trust Square Riyadh lancieren, nachdem wir bereits eine strategische Partnerschaft mit dem saudischen Investitionsministerium unterzeichnet haben.“ ce/mm

Hashgraph Association und Trust Square unterstützen künftig gemeinsam innovative DeepTech-Unternehmen. Symbolbild: DeltaWorks/Pixabay
Events




Aktuelles
Der neue Studiengang MAS Digital Real Estate Management HWZ der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) soll bezüglich der Chancen weiterbilden, die Prozessoptimierungen dem Immobiliensektor bieten. Das berufsbegleitende Weiterbildungsangebot richtet sich an Führungs- und Fachverantwortliche im Immobilienmanagement.
Studienleiter Dr. Peter Staub weist in einer Medienmitteilung darauf hin, dass die Immobilienbranche bis heute bezüglich der Digitalisierung fast allen Branchen „teilweise deutlich“ hinterherhinke. Der ganze Sektor sei „gut beraten, jetzt neue Technologien zu adaptieren und den Rückstand bei der Digitalisierung und KI rasch aufzuholen“. Anders seien relevante Kosten- und Ergebnisoptimierungen und eine deutliche Strategie gegen den Fachkräftemangel „kaum mehr zu bewältigen“.
Künstliche Intelligenz sei der Schlüssel zur Modernisierung der Branche, wird Markus Streckeisen zitiert. Er ist Gesamtverantwortlicher der Immobilienprodukte an der HWZ und Studiengangsleiter des bestehenden MAS in Real Estate Management HWZ. „Datenmanagement, Plattformlösungen und Automatisierungsschritte reduzieren die laufenden Kosten und treiben Innovationen voran“, auch hinsichtlich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft.
Der in drei Modulen buchbare Studiengang konzentriert sich auf die Schwerpunkte smarte Geschäftsmodelle, datengestützte Wertschöpfung und nachhaltiges Lifecycle Management. Vorgesehen sind Kooperationen mit Dozierenden von Hochschulen wie der Universität St.Gallen und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Beginn ist im September 2024. ce/mm

Dr. Peter Staub, Studiengangsleiter des MAS Digital Real Estate Management HWZ. Bild: Ausschnitt aus Video/HWZ
Aktuelles
Foodtech-Pionier Planted präsentiert mit dem planted.steak seine neueste Innovation. Weil dieses laut einer Unternehmensmitteilung nur das erste von zahlreichen innovativen Produkten der neuen sogenannten Whole-Muscle-Plattform sein soll, stellt das Unternehmen gleichzeitig auch die strategische Erweiterung seiner Produktionskapazitäten vor: eine neue Fermentationsanlage am Standort in Kemptthal.
Zur Beschleunigung der Whole-Muscle-Plattform hatte die Innovationsagentur Innosuisse Planted Anfang 2023 im Rahmen des Swiss Accelerator-Programms 2 Millionen Franken zugesprochen. Dies habe es Planted ermöglicht, sein Steak auf Fermentationsbasis nur ein Jahr später auf den Markt zu bringen. Es steht ab sofort auf der Speisekarte namhafter europäischer Restaurants und einer österreichischen Burger-Kette. Die Einführung über D2C-Kanäle sowie im Detailhandel in ganz Europa ist noch in diesem Jahr geplant.
Der Einsatz der Fermentationstechnologie ermöglicht es Planted den Angaben zufolge, „neue saubere und gesunde Proteinquellen zu finden und gleichzeitig den Geschmack und die Natürlichkeit zu verbessern“. „Das überwindet bisherige Grenzen der alternativen Proteine.“ Das Steak besteht ausschliesslich aus natürlichen Zutaten wie Sojaprotein, Rapsöl, Bohnen- und Reismehl sowie einer Mischung aus mikrobiellen Kulturen.
„Wir sind stolz, einer der wenigen Innovatoren von Fleisch auf pflanzlicher Basis zu sein, der alle Schritte des Produktionsprozesses übernimmt – von der Forschung und Entwicklung bis zur industriellen Produktion“, wird Planted-Mitgründer Lukas Böni zitiert. „Die zusätzlich neue Produktionsstätte ermöglicht Planted einen sehr schnellen Übergang von der Pilotphase zur industriellen Produktion.“ ce/mm

Planted bringt das erste fermentierte Steak seiner Art auf den Markt. Bild: Planted Foods AG
Aktuelles
Der kürzlich veröffentlichte Swiss HealthTech Report von KAPSLY Ventures bietet wertvolle Einblicke in die sich rasch entwickelnde Landschaft des Schweizer HealthTech-Sektors. Hier sind die wichtigsten Ergebnisse:
Insgesamt unterstreicht der Swiss HealthTech Report die Dynamik und das Potenzial des Sektors und bietet wertvolle Einblicke für die Akteure der gesamten Branche.
Die Ökosystemkarte und der vollständige Bericht können hier heruntergeladen werden.

Aktuelles
Zeitgleich zum Weltwirtschaftsforum in Davos lud der ETH-Bereich hochrangige Gäste aus Politik, Forschung und Wirtschaft ins WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos ein, darunter Bundesrat Guy Parmelin, Nationalratspräsident Eric Nussbaumer, Staatssekretärin Martina Hirayama sowie zahlreiche Rektorinnen und Rektoren von Schweizer Universitäten. Hausherr und Institutsleiter Jürg Schweizer freute sich über das grosse Interesse: «Es ist schön, hier, im höchstgelegenen Forschungsinstitut des ETH-Bereichs, zu zeigen, was Forschende des Bereichs leisten, sowohl für die Wissenschaft als auch für die Gesellschaft.» Forschende der beiden Hochschulen ETH Zürich und EPFL sowie der Forschungsanstalten PSI, WSL, Empa und Eawag gaben Einblicke in ihre Arbeit.
Christoph Hegg, «Acting Director» der WSL erklärte: «Es ist wichtig, den Entscheidern in der Politik zu zeigen, dass Innovationen nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Gesellschaft voranbringen.» Eine besondere Rolle dabei spielt, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei auch über den eigenen Tellerrand schauen und im engen Austausch mit Forschenden auf der ganzen Welt stehen. «Ein Pfeiler unseres Erfolgs sind internationale Kooperationen mit Forschenden auf der ganzen Welt, von denen auch die Schweiz profitiert», sagte Michael Hengartner, Präsident des ETH-Rats.
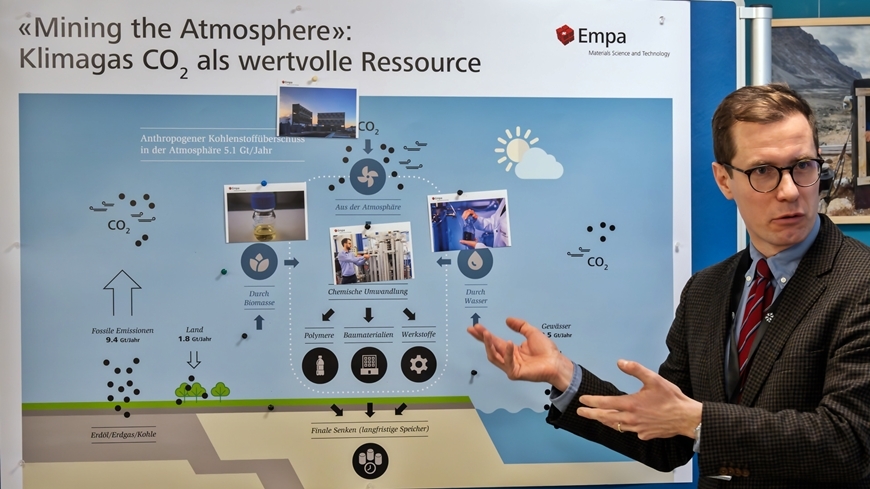
Mateusz Wyrzykowski, Co-Leiter des Empa-Forschungsschwerpunkts «Gebaute Umwelt», stellt die neue Forschungsinitiative «Mining the Atmosphere» vor. Dabei geht es darum, das Klimagas CO2 in grossem Stil der Atmosphäre zu entziehen, um aus diesem «Rohstoff» neuartige Materialien, etwa für den Baubereich, zu entwickeln. Bild: Luzia Schär
Events

Aktuelles
Fragen wie diese thematisierten die verschiedenen Referentinnen und Referenten am Hochschultag in Wädenswil, der laut Jean-Marc Piveteau Anlass zur Reflexion über die Rolle der ZHAW bot.
Drei Punkte hob der Rektor der ZHAW in seiner Eröffnungsrede hervor, die aus seiner Sicht zentral seien: Die Verankerung im europäischen Hochschulraum, innovatives Denken und Handeln sowie die Fokussierung auf Nachhaltigkeit in Lehre und Forschung.
Welche Konsequenzen auf der Führungsebene gefordert sind, zeigte Nicoletta Piccolrovazzi in ihrem Keynote-Beitrag «Führung für einen nachhaltigen Wandel» auf. Die Mitbegründerin und Vorsitzende der Applied Sustainability GmbH, welche Unternehmen und Organisationen in Sachen Nachhaltigkeit berät und unterstützt, zeigte auf, dass nachhaltiges Handeln ein systemisches Denken voraussetze, welches heute insbesondere auf Ebene der Führung noch zu wenig etabliert sei – dort gelte es anzusetzen.
Im anschliessenden Gespräch mit der Kommunikationsdozentin Claudia Sedioli, die durch den Abend führte, präzisierte sie ihre Botschaft. Wir müssen lernen, in jungen Jahren verinnerlichte Glaubenssätze zu verlernen – und dadurch bereit werden, Neues zu lernen.
Gastrednerin Silvia Steiner, Bildungsdirektorin des Kantons Zürich, betonte die Wichtigkeit von Beständigem in Zeiten des Wandels. Die ZHAW, so Steiner, sei das beste Beispiel für eine Institution mit stabilem Fundament. Solide Bildung stelle die nötige Basis für den gesellschaftlichen Wandel dar.
Mit ihrem Angebot trage die ZHAW zur Bekämpfung des Arbeitskräftemangels bei. Ihr Ausbildungsmodell stosse im Ausland auf Interesse.
Mit diesen Präsentationen nahmen die Abschlussworte von Nicoletta Piccolrovazzi Gestalt an. Sie hoffe, dass wir das Wort Nachhaltigkeit dereinst nicht mehr verwenden, sondern selbstverständlich entsprechend handeln werden.
Präsentation Keynote-Speaker Nicoletta Piccolrovazzi: «Führung für einen nachhaltigen Wandel»

v.l.n.r.: Ximena Franco, Salome Berger, Silvia Steiner, Anke Kaschlik, Jean-Marc Piveteau, Claudia Sedioli, Nicoletta Piccolrovazzi, David Jenny, Olivia Frigo-Charles
Dieses Video kommt von YouTube
Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.
Aktuelles
An der hybriden Fachtagung „SVSM Dialog Wirtschaftsförderung“ trafen sich in Olten Standort- und Wirtschaftsförderer aus der ganzen Schweiz. Anlass waren einerseits der fachliche Austausch und das Networking, andererseits die Verleihung der alljährlichen SVSM Awards. Diese Auszeichnungen werden seit 2007 von der Schweizerischen Vereinigung für Standortmanagement SVSM, dem Dachverband der Schweizer Wirtschafts- und Standortförderungen, vergeben. Der Dachverband zeichnet damit zielgerichtete, effektive und innovative Projekte aus dem Standortmarketing, der Standortentwicklung und der Wirtschaftsförderung aus.
12 Bewerbungen, fünf Nominierte, zwei Awards
Für die diesjährigen Awards gingen 12 Bewerbungen aus der ganzen Schweiz ein. Eine Fach-Jury hat diese anhand festgelegter Kriterien bewertet und fünf Projekte für die Awards 2023 nominiert:
Mit Spannung erwarteten die Teilnehmenden in Olten die Ankündigung von Jury-Präsidentin und SVSM-Vorstandsmitglied Katharina Hopp, welches der nominierten Projekte tatsächlich einen Award in Empfang nehmen darf. „Die Entscheidung ist der Jury auch dieses Jahr nicht leichtgefallen“, schickte Hopp vorab. Bereits eine Nomination für den Award sei eine Auszeichnung und eine Anerkennung. Die begehrten Trophäen durften schliesslich Raphael von Thiessen von der Standortförderung Kanton Zürich und Sabrina Honegger von der Standortförderung Zürioberland entgegennehmen.
Award für Innovation-Sandbox Künstliche Intelligenz
Das Projekt „Innovation-Sandbox Künstliche Intelligenz“ der Standortförderung Kanton Zürich ist eine Testumgebung für die Umsetzung von KI-Vorhaben. Die Sandbox soll verantwortungsvolle Innovation fördern, indem die Verwaltung und teilnehmende Organisationen eng an regulatorischen Fragestellungen arbeiten und die Nutzung von neuartigen Datenquellen ermöglichen. Jury-Präsidentin Katharina Hopp lobte bei der Award-Verleihung den klaren strategischen Ansatz und betonte, dass Projekte wie die Sandbox dringend nötig seien, hinke die Seite 2/2 Schweiz im internationalen Vergleich gerade im Bereich des regulatorischen Aspekts im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz deutlich hinterher. Auch die Tatsache, dass sich eine kantonale Stelle mit Unternehmen vernetzt, um gemeinsam den Hightech-Standort Schweiz zu fördern, halte die Jury für bemerkenswert.
Award für Plattform „Echt regional“
Der zweite Award ging an die Standortförderung Zürioberland für ihr Projekt „Echt regional“. Dabei handelt es sich um ein IT-System zur einfachen Zertifizierung von Regionalprodukten. Diese war bis anhin mit sehr viel Aufwand verbunden, was einige Produzenten von der Zertifizierung abgehalten hatte. Die neue Plattform, der sich bereits mehrere Regionalmarken angeschlossen haben, vereinfacht den Prozess und lässt sich beliebig erweitern. „Die Standortförderung Zürioberland hat zwar die Initiative ergriffen, aber keine Insellösung geschaffen, sondern eine zukunftsweisende Plattform mit viel Potenzial“, so Jury-Präsidentin Hopp an der Verleihung. Die Stärken der Schweizer Regionalprodukte würden mit diesem digitalen Showcase in den Fokus gerückt.
Sonja Wollkopf Walt ist Standortmanagerin des Jahres
Anlässlich der Verleihung der SVSM Awards zeichnet der Dachverband jedes Jahr auch eine verdiente Persönlichkeit als Standortmanager/in des Jahres aus. Nachdem in den vergangenen Jahren beispielsweise Christoph Lang, Samih Sawiris oder Bruno Marazzi die Ehrung entgegennehmen durfte, entschied sich die Jury dieses Jahr für eine Ehrung in den eigenen Reihen: Sonja Wollkopf Walt, Managing Director der Greater Zurich Area, durfte in Olten die Auszeichnung als Standortmanagerin des Jahres 2023 entgegennehmen. Botschafter Eric Jakob, Leiter der Direktion für Standortförderung SECO und Jury-Mitglied der SVSM Awards, bezeichnete Wollkopf Walt in seiner Laudatio als „Pionierin und Inspiration für die nationale Standortpromotion“. Sie habe die Greater Zurich Area in schwierigen Zeiten neu positioniert und dank eines neuen Ansatzes – weg von der Geografie, hin zur Vermarktung von Ökosystemen, die keine Kantonsgrenzen kennen – Wachstum ermöglicht. „Vor einigen Jahren hast du in einem Interview auf die Frage nach deiner Laufbahnplanung geantwortet, dass du international arbeiten und etwas bewegen willst. Dies ist dir gelungen: Deine grossen Leistungen und Erfolge sind breit anerkannt – die heutige Auszeichnung zeugt davon.“
Aktuelles
Seit 2017 fördert der ETH-Bereich in seinem Strategischen Schwerpunkt "Personalized Health and Related Technologies" (PHRT) in Zusammenarbeit mit Schweizer Spitälern die Integration von ETH-Technologien in die klinische Praxis zum Wohle der Patienten.
Bernd Wollscheid, Vorsitzender des Gutachtergremiums, zeigte sich begeistert von den neu geförderten Projekten: "Durch die Unterstützung dieser drei von der Empa und dem PSI geleiteten Projekte ermöglicht PHRT, dass innovative Technologien, die an den Institutionen des ETH-Bereichs entwickelt wurden, mit klinischen Partnern an menschlichen Proben evaluiert werden können. Die erfolgreiche Umsetzung solcher Projekte und die weitere Erprobung in klinischen Studien sind die Grundlage für neue diagnostische und therapeutische Strategien, die den Patienten in Zukunft zugutekommen."
Die neuen Projekte, die nun von PHRT finanziert werden, sind ein weiteres Beispiel für das Engagement des ETH-Bereichs, gemeinsam mit seinen klinischen Partnern die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu verbessern. Durch den Einsatz von neuartigen Technologien und Algorithmen, die durch die Forschenden des ETH-Bereichs entwickelt wurden, zielen diese Projekte darauf ab, die klinische Entscheidungsfindung und die Therapie zu verbessern, was Patienten in der Schweiz und weltweit zugutekommt.
Das von Inge Herrmann von der Empa in Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital St. Gallen und der Cleveland Clinic (USA) vorgeschlagene Projekt zielt auf die Entwicklung eines Überwachungssystems zur Analyse der chirurgischen Drainageflüssigkeit nach Operationen im Verdauungstrakt. Basierend auf kolorimetrischen Sensoren sollen die Ergebnisse dieses Projekts dazu beitragen, Komplikationen nach derartigen Operationen zu verhindern und eine effizientere Gesundheitsversorgung für Patienten zu ermöglichen, die sich eines solchen Eingriffs unterziehen müssen.
Das von Serena Psoroulas am PSI in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Genf vorgeschlagene Projekt wird eine neue Form der Strahlentherapie, die so genannte Flash-Protonentherapie, in einem präklinischen Modell einer aggressiven Form von Hirnkrebs testen, von der hauptsächlich Kinder betroffen sind. Die Ergebnisse dieser Studien dürften den Weg für die erste klinische Studie ebnen, bei der dieser therapeutische Ansatz bei Kindern mit dieser Art von Krebs angewandt wird.
Das von Marco Stampanoni vom PSI geleitete Projekt zielt in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Zürich auf die Entwicklung eines Computertomographie-Verfahrens ab, das auf dem Röntgenphasenkontrast für die Mammographie basiert. Diese neue Technik erlaubt eine detailliertere Beurteilung des Weichteilgewebes als die klassische Röntgenaufnahme. Diese Studie wird die Fähigkeit zur Diagnose von Brustkrebs verbessern.
Über PHRT
"Personalized Health and Related Technologies" (PHRT) ist ein strategischer Schwerpunktbereich des ETH-Bereichs mit einer Laufzeit von 2017 bis 2024, der die personalisierte Medizin durch die Integration von Spitzentechnologien, Forschungskooperationen und innovativen klinischen Studien voranbringen soll. PHRT zielt darauf ab, die Kluft zwischen Wissenschaft und klinischer Praxis zu überbrücken und die Entwicklung und Umsetzung von transformativen Gesundheitsprojekten voranzutreiben.

Drei neue Projekte der Empa und des PSI haben im Rahmen einer Finanzierung durch PHRT zusammen eine Million Franken erhalten.
Events
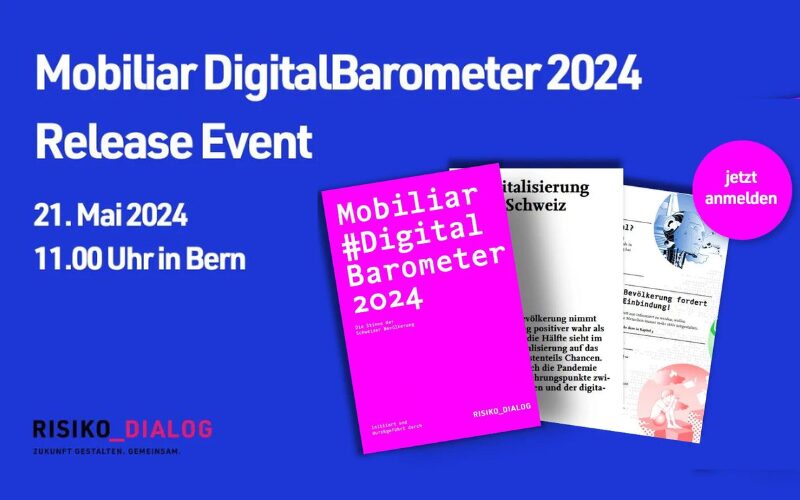
Aktuelles
Seit dem ersten Call im Jahr 2019 wurden 44 Fellows ausgewählt. Die 12 neuen Fellows starten mit ihren Projekten im Januar 2024 und befassen sich mit unterschiedlichen Themen:
David Jaggi von der School of Management and Law untersucht Publikationen von Unternehmen und Patenttexte, um mithilfe von Natural Language Processing und Machine Learning eine Methode zu entwickeln, um «Greenwashing» zu erkennen.
Alice Aubert vom Departement Life Sciences und Facility Management erforscht den Nutzen eines digitalen Tools für partizipatorische Entscheidungen. Im Projekt geht es insbesondere um «Trade-Offs» von nachhaltigen Entwicklungen. «Das DIZH-Fellowship erweckt eine Software zum Leben, die bisher unter experimentellen Bedingungen entwickelt und getestet wurde», erklärt Aubert.
Pasquale Cirillo von der School of Management and Law möchte mit Machine Learning der Industrie und den Regulierungsbehörden verlässliche Instrumente zu klimabezogenen finanziellen Risiken liefern. «Der Kampf gegen den Klimawandel erfordert enorme Geldbeträge. Unser Ziel ist es, die Finanzmärkte dabei zu unterstützen, ihren Teil dazu beizutragen, indem wir eine zuverlässigere Quantifizierung potenzieller finanzieller Verluste aufgrund des Klimawandels anbieten», sagt er.
Christian Rapp, ebenso von der School of Management and Law, befasst sich mit dem Unterrichten von akademischem Schreiben und wird dieses auf neue KI-Technologien ausrichten.
Auch beim Projekt von Malgorzata Anna Ulasik vom Departement Angewandte Linguistik geht es um Texte und KI. Sie wird Textproduktion mit und ohne Textgeneratoren vergleichen, um so die besten Praktiken zu identifizieren.
Michelle Haas vom Departement Gesundheit knüpft an ein kürzlich abgeschlossenes Projekt an, in welchem die ZHAW und ZHdK ein Exergame zur Rehabilitation von Kreuzbandverletzungen entwickelt hat, vertieft das Wissen und validiert weitere wichtige Aspekte.
Sven Hirsch vom Departement Life Sciences und Facility Management erforscht das Konzept des digitalen Zwillings im Gesundheitswesen, um patientenspezifische pathophysiologische Systeme virtuell zu reproduzieren.
Weitere Informationen zum Fellowship-Programm und den weiteren geförderten Fellows (Michael Jüttler, Florian Spychiger, Andrea Günster, Andreas Schönborn und Yulia Sandamirskaya) finden Sie auf der Website von ZHAW digital.

Inno-Hubs
Digital Winterthur ist eine Organisation, die sich auf die Förderung von Digitalisierung, Technologie und Innovation in der Region Winterthur konzentriert. Durch die Organisation von regelmässigen Veranstaltungen, Projekten und Partnerschaften schafft Digital Winterthur eine Plattform für den Austausch von Ideen, Wissen und Erfahrungen im digitalen Bereich. Die Organisation bringt Mitglieder, Experten und die breite Bevölkerung von Winterthur zusammen, um die digitale Entwicklung in der Stadt voranzutreiben. Dabei liegt der Fokus auf der Schaffung eines Innovationshubs, der die Zusammenarbeit fördert und dazu beiträgt, Winterthur als einen Ort für fortschrittliche digitale Technologien zu positionieren. Digital Winterthur könnte auch eine Rolle bei der Integration von Technologien in verschiedenen Bereichen spielen, von Wirtschaft und Bildung bis hin zu Umwelt- und Stadtentwicklung.
Inno-Hubs
Launch Control ist ein Winterthurer Incubator & Accelerator, welcher sich an Startups und innovative Ideen in der Frühphase richtet. Egal in welcher Phase du mit deiner Idee oder deinem Startup stehst: Wir helfen dir weiter!